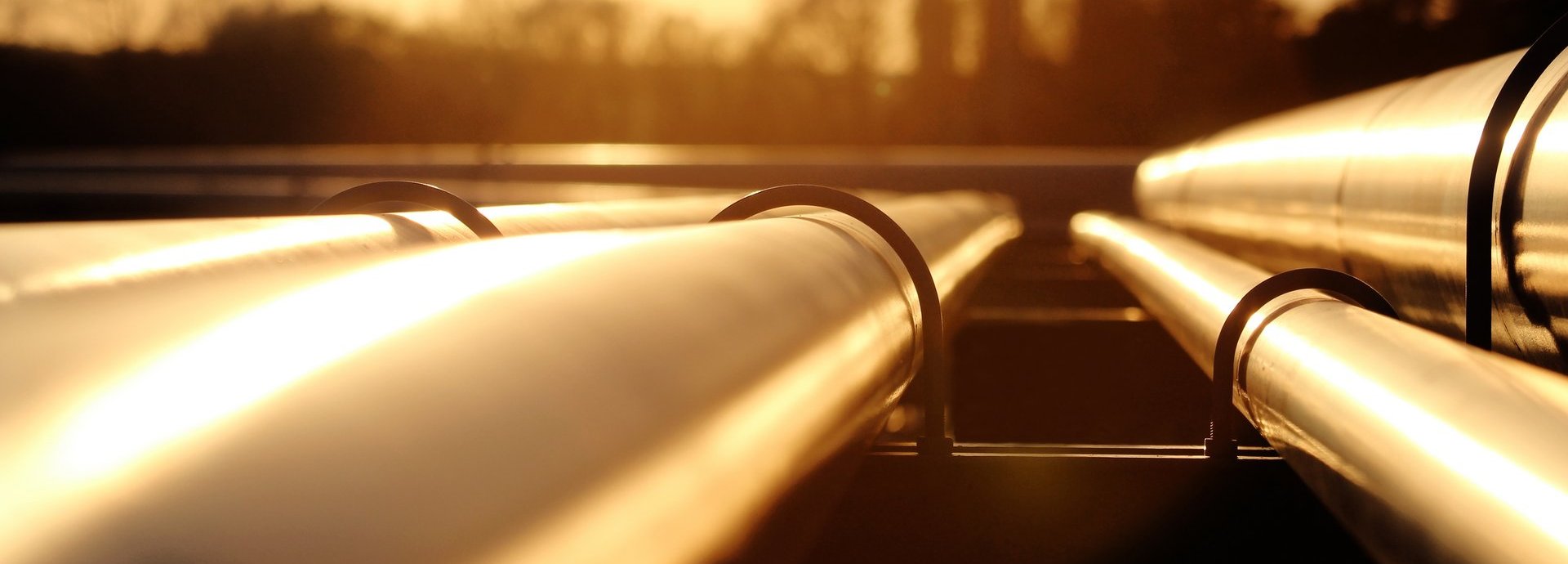
Im Koalitionsvertrag ist die Vorgabe verankert, wonach neue Heizungen auf Basis von mindestens 65 Prozent Erneuerbaren Energien betrieben…
25. August 2022
Im Koalitionsvertrag ist die Vorgabe verankert, wonach neue Heizungen auf Basis von mindestens 65 Prozent Erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges hat der Gesetzgeber die 65-Prozent Vorgabe ab dem 1. Januar 2024 festgelegt. Zur Umsetzung hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) ein Konzept erarbeitet und am 18. Juli 2022 im Rahmen der öffentlichen Konsultation den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt.
Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) begrüßt die Einführung der 65-Prozent Nutzungspflicht für den Einbau neuer Heizungen ab 2024. Positiv hervorzuheben ist die rechtzeitige Verbandseinbindung von einem Monat. Dies ist auch deswegen angemessen, da die 65-Prozent Regelung ein entscheidender Faktor in der Transformation der Wärmeversorgung im Gebäudesektor einnimmt. Flankiert mit wirkungsvollen Förderprogrammen wird eine ausgewogene, aber konsequente Ausgestaltung des Nutzungsgebots den Einsatz Erneuerbarer Energien beim Heizungstausch deutlich steigern können. Um dies zu gewährleisten, kommentiert der BEE das Konsultationspapier zur 65-Prozent Nutzungspflicht mit den folgenden Schwerpunkten:
Die Umsetzbarkeit der genannten Kernpunkte werden zusammen mit der der Beantwortung der Fragen aus dem Konsultationspapier in den folgenden Kapiteln erläutert. Diese wurden in Zusammenarbeit des BEE mit seinen Mitgliedsverbänden erstellt und machen einen Vorschlag, wie die 65-Prozent Nutzungspflicht zu einem Booster der Wärmewende werden kann.
Zur Erfüllung des Nutzungsgebots stehen ausreichend erneuerbare Wärmeoptionen zur Verfügung, die sich mit ihren individuelle Vorteilen gegenseitig ergänzen. Daher spricht sich der BEE dafür aus, die Erfüllungsoptionen gleich zu behandeln und auf ein Stufenmodell zu verzichten (Siehe Punkt 3).
Nah- und Fernwärmenetze stellen ein probates Instrument dar, um Erneuerbare Wärme zu erschließen und Gebäuden auch bei hoher Bebauungsdichte zur Verfügung zu stellen. Den Anschluss an ein Wärmenetz als Erfüllungsoption anzuerkennen, setzt voraus, dass tatsächlich wirksame Maßnahmen ergriffen werden, die für eine Dekarbonisierung der Wärme- und Gebäudenetze sorgen.
Deshalb steht die 65%-Regelung in einem engen Zusammenhang mit dem angekündigten Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Bis dieses vorliegt, ist nicht absehbar, wie verbindlich und verlässlich Transformationspläne und Netzausbaupläne von Wärmenetzbetreibern sein werden. Jegliche Anerkennung oder sogar vorrangige Behandlung von Wärmenetzen als Erfüllungsoption für 65% Erneuerbare Energien steht unter dem Vorbehalt, dass diese schnellstmöglich dekarbonisiert werden.
Ab dem Jahr 2026 muss daher das Vorliegen eines verbindlichen Investitionskonzepts zur vollständigen Umstellung der Wärmeversorgung bis 2045 auf 100% Erneuerbare Wärme oder Abwärme vorgelegt werden. Dies muss verpflichtend für alle Netze gelten, welche bis zum Anschlussdatum einen niedrigeren Anteil als 65% Erneuerbare Energien aufweisen. Dieser Transformationsplan muss verbindlich für die Umstellung des Wärmenetzes sein. Weitere Anmerkungen zur Gewährleistung der Verbindlichkeit können den Antworten der Fragen 4 und 5 entnommen werden.
Darüber hinaus ist von zentraler Bedeutung, dass - wie im Konzeptvorschlag vorgesehen - Netze, die bereits über mindestens 65 Prozent Erneuerbare Energien verfügen, von der Pflicht zur Vorlage eines Transformationsplans ausgenommen werden. Netze, die bereits über 65 Prozent Erneuerbare Wärme verfügen, sind typischerweise die weit verbreiteten ländlichen Nahwärmenetze, die nur über vergleichsweise wenige Anschlussnehmer:innen und kleinere Durchsatzmengen verfügen. Die Kosten und der Aufwand für die Erstellung eines Transformationsplans wären gemessen an der Anzahl der Wärmekunden und der abgesetzten Wärmemengen für solche Wärmenetze unverhältnismäßig.
Wärmepumpen als vollständig Erneuerbare Energie anzuerkennen, wird der Tatsache eines stetig zunehmenden Anteils Erneuerbarer Energien am Strommix gerecht. Der Satz „Zudem soll der Stromanteil, der aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen wird, über die reguläre Nutzungsdauer einer Wärmepumpe 100 Prozent klimaneutral erzeugt werden“ ist in dieser Hinsicht missverständlich formuliert. Die Energiewende bildet eine Grundvoraussetzung für Wärmewende und Klimaschutz.
Bei der Ausgestaltung des Gesetzentwurfs sollte berücksichtigt werden, dass neben den im vorliegenden Konzept aufgezählten Wärmequellen noch weitere Wärmequellen genutzt werden können, die als Erneuerbare Energie oder unvermeidbare Abwärme gelten. Das trifft etwa auf Abluft, (gewerbliche) Abwärme und PVT-Kollektoren zu.
Der im Konzeptpapier formulierte Anspruch, dass Erneuerbare Energien durch entsprechende Vorgaben in der Wärmeversorgung möglichst effizient eingesetzt werden sollen, ist zu unterstützen. Dabei ist darauf zu achten, dass die im Wettbewerb zueinanderstehenden Technologien nicht mit unterschiedlichem Maß beurteilt werden, und dass nationale Produktvorgaben durch Art. 6 der europäischen Ökodesign-Richtlinie 2009/125 eingeschränkt sind.
Biomasseheizungen (in den allermeisten Fällen sind dies Holzheizungen) zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen in aller Regel keine anderen Brennstoffe sinnvoll eingesetzt werden können. Dies muss auch für die hier adressierten Biomasseheizungen auf Basis flüssiger Biomasse (in aller Regel: Pflanzenöle) gelten. Ölkessel, in denen neben Heizöl auch Bioheizöl eingesetzt werden können, dürfen nicht mit Festbrennstoffheizungen für Holz und andere nachwachsende Rohstoffe gleichgesetzt werden.
Nachhaltigkeitskriterien für Biomasseheizungen: Für den Einsatz „nachhaltiger“ Biomasse als Erfüllungsoption sollte auf die bereits rechtlich etablierten Nachhaltigkeitskriterien und Größengrenzen der Erneuerbare Energien Richtlinie der EU (EU 2018/2001 – RED II) zurückgegriffen werden. Die RED II definiert umfangreiche und rechtlich verbindliche Nachhaltigkeitskriterien für die Wärmeerzeugung aus fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse sowie den Nachweis für die Einhaltung mittels unabhängiger Zertifizierung. Zur Vermeidung konkurrierender und inkongruenter Nachhaltigkeitsanforderungen darf hier nach Ansicht des BEE nicht von den europarechtlichen Vorgaben der RED II abgewichen werden, auch um internationale Verzerrungen und unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen zu vermeiden. Die RED II-Kriterien sind zudem nicht nur in einem umfassenden Rechtssetzungsprozess auf EU-Ebene definiert worden, sondern auch in der Praxis bereits bekannt und angewendet. Einen nationalen Alleingang für die Definition eigener Nachhaltigkeitskriterien oder abweichender Größenschwellen lehnt der BEE entschieden ab.
Das Konzept von BMWK und BMWBS schlägt vor, dass beim Einsatz von Biomethan und anderen grünen Gasen Vermieter:innen die Kosten vollständig übernehmen, die über den Grundversorgungstarif für Gas hinausgehen.
Es ist unklar, ob dafür das Wirtschaftlichkeitsgebot im Mietrecht (§ 556 Abs. 3, § 560 Abs. 5 Bürgerliches Gesetzbuch) eine ausreichende Grundlage bietet oder es einer zusätzlichen Mieterschutzklausel bedarf, welche konkret auf die Umsetzung der 65%-Regelung aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) abstellt. Um Rechtssicherheit herzustellen, wäre es aus Sicht des BEE sinnvoll, klarzustellen, dass die Kostenübernahme durch Vermieter:innen geboten ist, wenn Bezugskosten für die Biomasse mindestens 5 % über den Grundversorgungstarif für Erdgas hinausgehen.
Diese Regelung sollte auch auf flüssige Bioenergieträger ausgeweitet werden, die in Ölkesseln ohne weitere technische Anpassungen anstelle von Heizöl eingesetzt werden können.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass - wie im Konzeptpapier dargelegt - der Einsatz von grünen Gasen an den Nachweis mittels eines Massebilanzverfahrens gebunden sein sollte. Der bilanzielle Einsatz von grünen Gasen sollte also maximal in dem Maße anrechenbar sein, in welchem dieses Gas an anderer Stelle in die Gasinfrastruktur eingespeist wurde. Im Falle von Wasserstoff muss diese Menge zudem den technischen Aufnahmemöglichkeiten der lokalen Gasinfrastruktur und des Endgeräts entsprechen. Für die Nutzung von flüssiger, fester und gasförmiger Biomasse sowie von Wasserstoff wie auch für alle anderen Erfüllungsoptionen muss somit gelten: Zur Anerkennung als zu mindestens 65% erneuerbare Versorgungslösungen müssen sie den Einsatz fossiler Energieträger und die Freisetzung von CO2-Emissionen in Deutschland nicht nur bilanziell, sondern auch physisch reduzieren.
Die Anforderung, reine Stromdirektheizungen nur in besonders gut gedämmten Häusern einzusetzen, ist zu präzisieren. Der Begriff „besonders gut gedämmte Häuser“ sollte aus Sicht des BEE mindestens dem Wärmeschutz eines Passivhauses entsprechen. Die Erfüllungsoption darf sich darüber hinaus nur auf direktelektrische Raumheizungsgeräte gem. Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG erstrecken und die im Baumarkt erhältlichen Elektroheizer nicht einbeziehen.
Die Einführung eines Stufenverhältnisses zur Erfüllung der 65%-Nutzungspflicht ist aus folgenden Gründen abzulehnen, wenn Maßnahmen getroffen werden, um eine ausreichende Transparenz zu Kosten und Verfügbarkeit von fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse sowie von Wasserstoff herzustellen und Mietende vor Investitionsentscheidungen geschützt werden, welche die Betriebskostenentwicklung unzureichend berücksichtigen.
1) Für die Akzeptanz der Maßnahmen zur Senkung von Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor ist es entscheidend, Eigentümer:innen möglichst große technische und wirtschaftliche Freiheitsgrade zu gewähren, damit sie den Weg wählen, der am besten zu ihrem Gebäude und ihren Bedürfnissen bzw. den Mietenden passt.
Aufgrund der langen Nutzungsdauer und der damit verbundenen Gefahr von Lock-in-Effekten muss bei der Erfüllungsoption Gasheizung das Ziel der 100%igen Erneuerbaren Energienutzung bis zum Jahr 2024 ohnehin schon heute berücksichtigt werden. Dazu muss bei der Nutzung von grünen Gasen zur Erfüllung der 65%-Nutzungspflicht ein Plan zur späteren Aufstockung des Bezugs grüner Gase, Umrüstung der Anlage oder entsprechenden Absenkung des Gebäudeenergiebedarfs beigefügt werden. Dies ist auch eine Transparenz-fördernde Maßnahme, die den Verbraucher:innen einen Vergleich und eine effiziente Wahl der Wärmelösung ermöglicht.
Zudem bestehen eine Reihe von möglichen Fällen, die sich ordnungsrechtlich kaum alle als Ausnahmen auffangen lassen:
2) Aus Systemsicht ist ein breiter Technologiemix ratsam. Speziell in Regionen mit einem hohen Stromverbrauch und einer geringen Erneuerbaren Stromerzeugung kann die Nutzung von biogenen Brennstoffen das Stromsystem entlasten. Dies gilt insbesondere für Süddeutschland mit einer hohen Stromnachfrage bei geringer Windstromerzeugung.
3) Eine Abstufung setzt Fachkräfte an der falschen Stelle ein, ist unwirksam, verzögert die Wärmewende und führt zu Zusatzkosten für die öffentliche Hand und/oder Hauseigentümer.
Das vorgeschlagene Konzept sieht als Kriterien, die eine Wahl einer Erfüllungsoption aus Stufe 2 zulassen, vor, dass „die vorrangigen Erfüllungsoptionen der Stufe 1 aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich oder zulässig sind oder wirtschaftlich zu unvertretbar hohen Kosten führen würden“, was wiederum „durch einen Sachkundigen zu bestätigen [ist], nachdem dieser eine Begutachtung von Heizung und Gebäude vorgenommen sowie ein Beratungsgespräch mit dem Gebäudeeigentümer geführt hat.“
Eine solche Regelung führt zu übermäßigem bürokratischen Aufwand sowohl für Eigentümer:innen, für Fachkräfte der ausführenden Unternehmen und für die öffentliche Hand und damit zu zusätzlichen Kosten und Verzögerungen bei der Wärmewende. Dabei ist es besonders gravierend, dass dringend für die Umsetzung der Maßnahmen benötigte Fachkräfte eingesetzt werden müssen, um diese Prüfungen vorzunehmen und die dafür notwendigen Bescheide zu erstellen. Problematisch ist, dass in dem Konzept keine präzisen und empirisch überprüfbaren Kriterien aufgeführt werden, die sich rechtssicher überprüfen ließen. Des Weiteren ist fraglich, ob Sachkundige tatsächlich willens wären, einen solchen Konflikt mit Hauseigentümer:innen zu suchen. Schließlich ist zu bezweifeln, ob diese Regelung einer Kosten-Nutzen Logik entspricht: In sämtlichen Behörden und Handwerksbetrieben besteht akuter Fachkräftemangel, sodass der Überprüfungsprozess und damit die Wärmewende deutlich verzögert werden würde und die Kosten für die öffentliche Hand und/oder die Hausbesitzer:in unverhältnismäßig stiegen. Angesichts des großen zeitlichen Drucks der Wärmewende und des Vorhabens der Regierungsparteien, Hemmnisse und Hürden für den Ausbau Erneuerbarer Energien abzubauen, ist eine Unterteilung der Erfüllungsoptionen deshalb nicht sinnvoll.
4) Eine Abstufung der Erfüllungsoptionen ist nicht erforderlich, solange eine ausreichende Transparenz zu Kosten und Verfügbarkeiten von fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse sowie von Wasserstoff gegeben ist und Mieterschutzklauseln dafür sorgen, dass Vermietende diese Aspekte beim Heizungstausch ausreichend berücksichtigen.
Dabei ist darauf zu achten, dass sowohl Gebäudeeigentümer als auch Mieter:innen noch vor der Beauftragung einer neuen Heizung umfassende Informationen zu den über die nächsten Jahre zu erwartenden Betriebskosten erhalten. Es sollte vermieden werden, dass Installateur:innen sich darauf zurückziehen, einfach wie bisher Gaskessel zu installieren, und die Betroffenen, darunter evtl. auch Mietende, mit den Folgen der sich verändernden Energiepreislage allein gelassen werden.
Zudem ist unklar, ob das Wirtschaftlichkeitsgebot im Mietrecht (§ 556 Abs. 3, § 560 Abs. 5 Bürgerliches Gesetzbuch) eine ausreichende Grundlage bietet, um Mietende davor zu schützen, dass Gebäudeeigentümer:innen ihre Entscheidung nur aufgrund der Investitionskosten treffen und Verfügbarkeit und Preise für Biomasse bzw. Wasserstoff nicht berücksichtigen. Um Rechtssicherheit herzustellen, wäre es aus Sicht des BEE sinnvoll, in einer zusätzlichen Mieterschutzklausel klarzustellen, dass die Kostenübernahme durch Vermieter:innen geboten ist, wenn Bezugskosten für die Biomasse mindestens 5 % über den Grundversorgungstarif für Erdgas hinausgehen.
a) Heizungshavarie:
Da Biomasse und grüne Gase eine Option zur Erfüllung der Nutzungspflicht darstellen, erschließt sich hier nicht, warum von einer fossilen Übergangslösung Gebrauch gemacht werden sollte. Den Verbraucher:innen kann hier die Möglichkeit eingeräumt werden, Bio oder grüne Gase vorübergehend zu nutzen und nach 3 Jahren zu einer anderen Erneuerbaren Option zu wechseln.
b) Gasetagenheizung:
Es ist nachvollziehbar, dass im Fall von Wohneigentumsgemeinschaften die Zeit für den Entscheidungsprozess um die Umsetzung verlängert werden soll. Da bei einer Gebäudeeigentümer:in kein Abstimmungsprozess von Nöten ist, sollte hier der Zeitraum über die 3 Jahre der Umsetzung hinaus nicht verlängert werden.
c) Einzelöfen:
Analog zur Gasetagenheizung sollte auch hier bei einer Hauseigentümer:in keine Verlängerung über die 3 Jahre hinaus gewährleistet werden.
d) Der Anschluss an ein Wärmenetz ist absehbar, aber noch nicht möglich:
Zur Anwendung dieser Ausnahmeregelung muss zunächst definiert werden, was ein Wärmeplan beinhaltet. Darüber hinaus muss auch hier sichergestellt werden, dass dieser Verbindlichkeit besitzt.
Wie beurteilen Sie die Einführung eines Stufenverhältnis bei den Erfüllungsoptionen?
Der BEE lehnt die Einführung eines Stufenmodells ab. (siehe 3. Erfüllungsoption mit Stufenverhältnis)
In welchem Verhältnis sollen Wärmepumpen zu Wärmenetzen stehen? Soll es auch möglich sein, eine dezentrale Wärmepumpe einzubauen, wenn vor Ort ein Wärmenetz vorhanden und ein Anschluss daran möglich ist?
Der Aussage auf S. 10, dass „der Anschluss an ein Wärmenetz eine vorrangige Erfüllungsoption sein“ sollte, ist in dieser Pauschalität zu widersprechen. Die meisten Fern- und Nahwärmenetze in Deutschland stehen noch ganz am Anfang ihrer Dekarbonisierung. Ob kommunale Wärmeplanung und Transformationspläne verlässlich zu einer Dekarbonisierung führen, ist derzeit ebenso unklar wie die Frage, ob Wärmenetze, die ihrer Verpflichtung zur Einbindung Erneuerbarer Energien nicht nachkommen, sogar wieder zurückgebaut werden.
Auf der anderen Seite ist der Modernisierungsprozess durch Wärmepumpen in vollem Gange. Neben der erneuerbaren Wärmeerzeugung lösen Wärmepumpen weitere Investitionen im Sinne der Energie- und Wärmewende aus: Um die Wärmepumpe effizienter zu betreiben, werden Gebäude vorsorglich oder nachträglich gedämmt. PV-Anlagen werden installiert, um möglichst viel eigenerzeugten Strom zu nutzen. Die Wirkungskette reicht bis hin zum E-Kfz, welches zusammen mit der Wärmepumpe die PV-Installation rechtfertigt. Nicht zuletzt sind Wärmepumpen die einzigen Wärmeerzeuger, mit welchen – je nach Produkt – auch energieeffizient gekühlt werden kann. Daher ist ein Vorrang von Wärmenetzen gegenüber Wärmepumpen zumindest unter den Vorbehalt zu stellen, dass das Wärmenetz bereits einen Anteil Erneuerbarer Energien von mindestens 65% aufweist.
Ist die Frist für die Vorlage eines Transformationsplans für die Wärmenetzbetreiber ausreichend? Wie kann die Einhaltung der Voraussetzung nachgewiesen werden?
Die Frist für die Vorlage eines Transformationsplans ab dem Jahr 2026 ist ausreichend, sollte aber ohne Ausnahmefälle verbindlich sein. Um die Einhaltung zu gewährleisten und den Akteuren dies auch zu ermöglichen, muss den Kommunen Unterstützung zukommen. Die Einführung eines konkreten Programms zur Vorbereitung der Kommunen im Zuge der Einführung der Kommunalen Wärmeplanung von Beginn an ist zu empfehlen.
Falls der Transformationsplan nicht oder nicht richtig umgesetzt wird: Wie sollte dann die Anrechnung erfolgen?
Dieses Versäumnis darf nicht auf Verbraucher:innen zurückfallen, welche sich auf den Transformationsplan verlassen haben. Bereits getätigte Anschlüsse zur Erfüllung der Nutzungspflicht sollten daher weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Für Neuanschlüsse hingegen sollte nur der tatsächliche Erneuerbare Energieanteil anerkannt werden, solange die Abweichung zum Transformationsplan bestehen bleibt. Dies setzt den Anreiz zu Ausgleichsmaßnahmen zur Einhaltung des Plans, um möglichen Neukund:innen die ganzheitliche Erfüllung wieder zu ermöglichen.
Kann Abwärmenutzung bei RLT-Anlagen als EE eingestuft und berücksichtigt werden?
Wärmerückgewinnung in raumlufttechnischen Anlagen ist als unvermeidbare Abwärme einzustufen und entsprechend zu berücksichtigen.
Sollte die Einführung einer zu Wärmepumpen vergleichbaren äquivalenten Leistungszahl der Wärmerückgewinnung vorgesehen werden?
Es wird präferiert, die gegenwärtige Bemessung nach einem in Prozent anzugebenden Nutzungsgrad vorerst beizubehalten.
Sollten die hybriden Systeme (bspw. Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ausgeweitet werden?
Der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann auch im Bestand sinnvoll sein. Dies wird daran deutlich, dass die Leistung einer Wärmerückgewinnung bei sinkenden Außentemperaturen zunimmt, was sich wiederum zunehmend positiv auf den Betrieb einer diese Wärmequelle nutzenden Wärmepumpe auswirken kann.
Welche weiteren Erfüllungsoptionen sehen Sie?
keine
Vor dem Hintergrund, dass alle Heizungen in Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral Wärme erzeugen müssen, stellt sich folgende Frage: Sollte der fossile Anteil bei Hybridanlagen nur zeitlich befristet zugelassen werden?
Besser erscheint es, diese 65 % als ersten Schritt anzusehen, der durch weitere gebäudepolitische Maßnahmen so ergänzt wird, dass das Ergebnis in den meisten Fällen 100% erneuerbar wird. Ohnehin ist davon auszugehen, dass der Heizungstausch in den meisten Fällen mit einer vollständig klimaneutrale Versorgungslösung durchgeführt wird.
Zur Erreichung der Klimaneutralität bei nur anteilig erneuerbaren Systemen sollte in erster Linie auf eine Absenkung der Gebäudeenergiebedarfe, eine (weitere) Dekarbonisierung der Versorgung mit gasförmigen und flüssigen Energieträgern und auf den geförderten Ersatz fossiler Heiztechnik durch neue Anlagentechnik (z.B. zusätzliches Wärmepumpenmodul) gesetzt werden.
Zeichnet sich im Rahmen der ersten Evaluierungen der 65%-Regelung ab, dass Gebäudeeigentümer sich in unzureichender Anzahl für Heizungsanlagen entscheiden, die vollständig erneuerbare Energien nutzen, kann ordnungsrechtlich nachgesteuert werden.
Welche Nachhaltigkeitskriterien halten Sie für flüssige, feste und gasförmige Biomasse für erforderlich?
Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Heizkesseln in der weit überwiegenden Zahl der Fälle um Kleinfeuerungsanlagen handelt. Sofern Nachhaltigkeitskriterien gelten, müssen diese also auch für Kleinfeuerungsanlagen handhabbar und verhältnismäßig sein. Dies ist nur möglich, wenn sie an bestehende, verbreitete Nachhaltigkeitssysteme anknüpfen, und keine eigenen neuen Anforderungen schaffen. Für die Bestimmung der Nachhaltigkeitskriterien sollte die EE-Richtlinie des EEG angewandt werden.
Bei der Anerkennung von Biomethan und anderer grüner Gase ist darauf zu achten, dass die Einspeisung in das deutsche Gasnetz erfolgt, sodass tatsächlich Erdgasverbräuche und CO2-Emissionen in Deutschland gesenkt werden.
1. Wie sollte die Umsetzung erfolgen, wenn aufgrund von Fachkräftemangel und Materialmangel der Einbau einer Wärmeerzeugungsanlage auf der ersten Stufe nicht möglich ist?
Der Fachkräftemangel führt zurzeit zu Wartezeiten von durchschnittlich einem halben Jahr. Zuvorderst sollten Förderanreize genutzt werden, vorausschauendes Handeln zu unterstützen und die Anzahl der Fälle, in welchen eine Heizung kurzfristig getauscht werden, zu minimieren. Handwerkskapazitäten würden jedenfalls durch einen weiteren Kapazitätsengpass verschärft, wenn im Rahmen des vorgeschlagenen Stufenmodells Energieberater den Einbau einer Biomasseheizung freigeben müssen.
Welche Erfüllungsoptionen sehen Sie im Fall eines außerplanmäßigen Heizungstauschs im Winter, bei denen ein Austausch mit einer der Optionen der ersten Stufe allein aus Zeitgründen kaum möglich ist?
Nach einer Havarie bleibt häufig zu wenig Zeit, um ad hoc eine Wärmepumpe zu installieren, welche die Gebäudeheizlast vollständig und optimal gerecht wird. Daher spricht auch diese Fallkonstellation dafür, auf eine Gleichbehandlung der Erfüllungsoptionen zu achten.
Gebäudeeigentümer:innen können zunächst einen Kessel installieren, der entweder Biomethan nutzt, und/oder binnen drei Jahren in eine Hybridheizung umgewandelt wird. Ordnungsrecht und BEG sollten Anreize schaffen, dass Gebäudeeigentümer sich binnen einer dreijährigen Frist möglichst für eine vollständig erneuerbare Wärmelösung entscheiden. Dafür sollte unter Umständen auch die Zwischenlösung, einschließlich deren Installation und Deinstallation, in die Förderung einbezogen werden.
Die Optionen zu den Härtefällen wurden im Abschnitt 4 bereits erläutert. Die hier vorliegende Regelung zur Nutzungspflicht berücksichtigt bereits umfassend Ausnahmefälle. Eine weitere Lockerung dieser Regelung birgt das Risiko einer zunehmenden Verwässerung.
Wie können Gasetagenheizungen oder Einzelöfen unter Einhaltung der 65%-EE-Vorgabe ausgetauscht werden, sofern keine Zentralisierung der Heizungsanlage geplant ist?
Solange die Zentralisierung der Heizungsanlage mit 65%-EE technisch möglich ist, so bildet die Umstellung eine unproblematische Erfüllungsoption. Die Grundlage für eine weitere Ausnahmeregelung ist dann nicht gegeben.
Welche Anforderungen muss das Wohneigentumsgesetz stellen, damit die Eigentümerversammlung fristgemäß die Entscheidung zur Erfüllung der Pflicht treffen kann?
Bis 2045 müssen alle Heizungen auf Erneuerbare Energien oder Abwärme umgestellt sein. Wie soll dieses Ziel in den Sonder- und Härtefällen erreicht werden?
Zur Dekarbonisierung der verbleibenden Heizkessel stehen mehrere Optionen zur Verfügung: die Absenkung der Gebäudeenergiebedarfe, die Dekarbonisierung gasförmiger und flüssiger Energieträger und die nachträgliche Umrüstung der Heizungsanlage.
Die Ausgestaltung der Härtefälle wurde bereits in Kapitel 4 erläutert. Weitere Ausführungen von Härtefällen sind nicht notwendig. Übergangslösungen wie elektrische Provisorien sind verfügbar. Für die Zielerreichung 100%-EE bis 2045 ist die Einführung der verkürzten Nutzungsdauer für Niedertemperaturkessen von 30 auf 20 Jahre zu empfehlen.
Wie beurteilen Sie die Möglichkeit von Zwischenlösungen durch temporär gemietete oder geleaste (ggf. gebrauchte) Gaskessel?
Sollten andere Provisorien in einem Härtefall nicht anwendbar sein, so kann die Nutzung von temporären Gaskesseln Abhilfe schaffen.
Wie lang sollten die Fristen für die Erfüllung der Härte- und Sonderfallregelung sein?
Sollen Nachtspeicherheizungen unter die Regelung für Einzelöfen fallen und beim Ausfall ausgetauscht werden müssen?
Beim Austausch von Nachtspeicherheizungen ist nicht einfach nur der Austausch eines Wärmeerzeugers notwendig, sondern auch der Einbau von Heizkörpern. Dies macht meist die Komplettmodernisierung notwendig, die in der Regel erst nach einem Auszug der Wohnungsnutzer:innen möglich ist. Oft lassen die rechtlichen Konstellationen eine solche Umstellung auch gar nicht zu. Daher braucht es für diese Gebäude sowie für nur mit Einzelöfen geheizte Gebäude ein umfassenderes Lösungskonzept. Auf diese besonderen Schwierigkeiten muss das Ordnungsrecht Rücksicht nehmen.
Welche Kreditprogramme oder Förderprogramme können die Zahl der Härtefälle reduzieren?
Spezielle Anreize und Fördersysteme braucht es für Wohnungseigentümergemeinschaften, für selbstgenutzte Gebäude mit Nachtspeicherheizungen oder ausschließlich Einzelraumfeuerungen und für Gebäude von Eigentümer:innen ohne weiteres Vermögen und niedrigem Einkommen. Für die letzte Zielgruppe war es die völlig falsche Maßnahme, die Kreditförderung für Einzelmaßnahmen einzustellen: Sie sind dringend auf eine Förderung angewiesen, da sie die Maßnahme nicht aus eigenen Mitteln vorfinanzieren können. Die Förderung enthält eine Schieflage, wenn sie nur Gebäudeeigentümer:innen mit entsprechendem Finanzpolster zugänglich ist.
Welche Rolle können Contracting-Angebote insbesondere zu Reduzierung der Anzahl von Härtefällen spielen? Mit welchen Maßnahmen kann der Bund das Angebot unterstützen?
Wie können Fördermaßnahmen die Erfüllung der 65%-EE-Vorgabe sinnvoll unterstützen?
Was gefordert wird muss auch gefördert werden können, wenn es sich um sehr anspruchsvolle Vorgaben handelt. auch für die Planungs- und Investitionssicherheit braucht es durchgehende Förderung statt Förder-stop-and-Go. Daher ist es kontraproduktiv, dass die BEG-Kreditförderung für Einzelmaßnahmen eingestellt wurde. Der Zugang zu Finanzierungskrediten muss für alle Gebäudeeigentümern gewährleistet werden. Die Differenzierung der Höhe der Fördersätze für unterschiedliche EE-Technologien ist kontraproduktiv, weil sie die Förderung unnötig verkompliziert. Sie benachteiligt außerdem Verbraucher mit eingeschränkten Umsetzungsmöglichkeiten.
Soll die verpflichtende Beratung nach 15 Jahren eingeführt werden? Welcher Sachkundige sollte die Beratung nach 15 Jahren durchführen können?
Wie kann unter Berücksichtigung der neuen Digitalisierungsmöglichkeiten eine Kontrolle des effizienten Betriebs stattfinden?
Welche Maßnahmen kann der Bund ergreifen, um Fachkräfteengpässe zu vermeiden?
Zum 1. Januar 2023 tritt die Initiative Energien Speichern e.V. (INES) dem Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) als Mitgliedsverband bei. Mit…
Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) begrüßt die politische Einigung zwischen dem Europäischen Parlament (EP) und dem Rat der Europäischen…
Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat auf seiner zweiten Delegiertenversammlung weitere Satzungsänderungen zur Stärkung der…
„Die Koalitionsfraktionen haben den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse (StromPBG) überarbeitet und dabei auch einige…
Heute vor einem Jahr wurde die neue Bundesregierung vereidigt. „Der klare Klimakurs aus dem Koalitionsvertrag ist zu einem Hindernislauf geworden“, so…
Heute berät der Bundestagsausschuss Klimaschutz und Energie über das Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse (StromPBG). Die Präsidentin des…