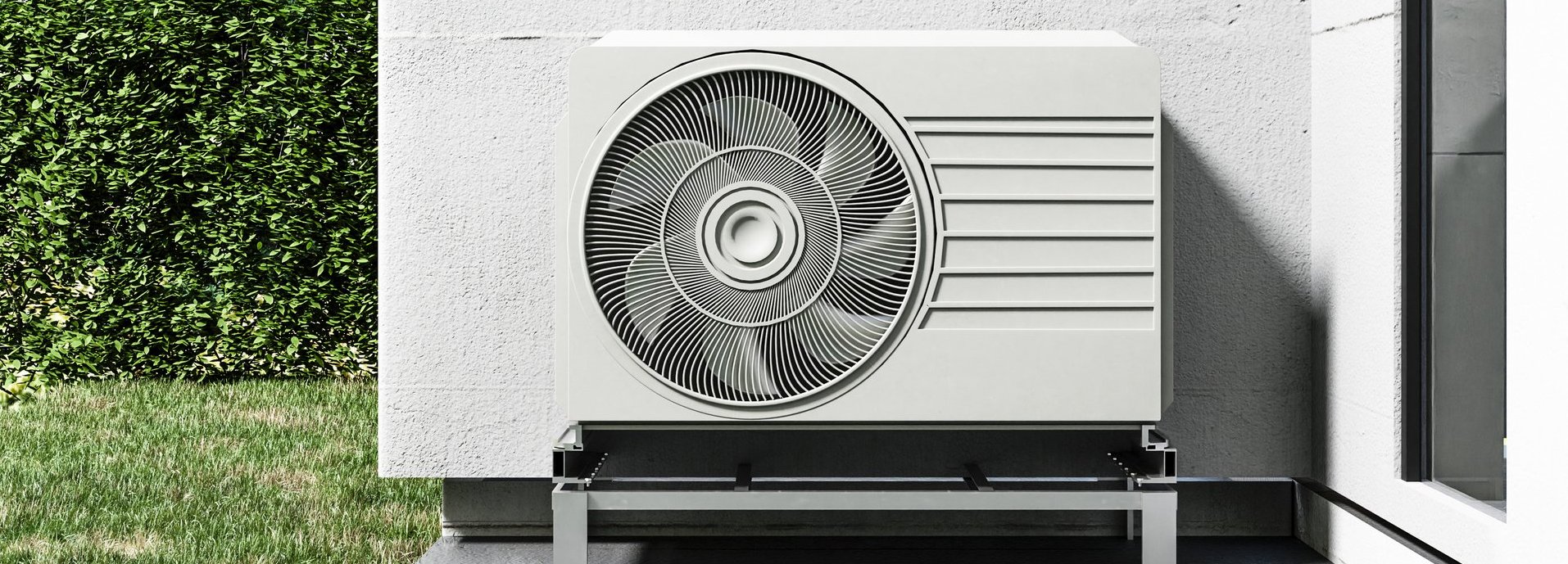
Der BEE begrüßt das GeoBG um den Aufbau dringend benötigter Infrastruktur für Geothermie, Wärmepumpen & Wärmespeicher zu beschleunigen.
21. Juli 2025
Die Festlegung dieser Infrastruktur als überragendes öffentliches Interesse trifft bei uns auf große Zustimmung und schließt eine gesetzliche Lücke.
Sowohl im GeoBG (§ 1, § 2, § 3) als auch in der vorgesehenen Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (Art. 3 Nr. 1) werden Begriffe nicht weit genug gefasst, um dem Zweck des Entwurfs zu entsprechen, den Ausbau von (Groß-)wärmepumpen in verschiedenen technischen Ausprägungen zu entbürokratisieren. Zuvorderst betrifft das die Formulierung von § 2 GeoBG, welche Nebenanlagen und Bohrungen unter den Anwendungsbereichen der anschließend aufgezählten Anlagen fasst, aber nicht weit genug greift, um alle Arten von Quellenanlagen umfassend abzudecken.
Die Erleichterungen des GeoBG sollten auch für Explorations- und Aufsuchungsmaßnahmen sowie für Anlagen zur Nutzbarmachung von Erdwärme (Wärmetauscher, Vorrichtungen zur Einspeisung in das Wärmenetz, ORC-Anlagen zur Umwandlung in elektrischen Strom) gelten.
Die Nutzung der Flusswärme unserer Fließgewässer birgt signifikante Potenziale und einen enormen Hebel für das Gelingen der Wärmewende mit Erneuerbaren Energien in Deutschland. Diese wichtige Technologie wird in dem Gesetzesentwurf derzeit jedoch noch nicht ausreichend adressiert.
Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme und begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf sehr, dessen Ziel es ist, den Aufbau dringend benötigter Infrastruktur für Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeicher zu beschleunigen. Die Festlegung dieser Infrastruktur als überragendes öffentliches Interesse trifft bei uns auf große Zustimmung und schließt eine gesetzliche Lücke.
Die Erschließung von Geothermie und weiteren Wärmequellen haben derzeit aufgrund teils komplexer Genehmigungsverfahren je nach Umfang einen Umsetzungszeitraum von mehreren Jahren, der durch eine Verfahrensvereinfachung stark verkürzt werden kann. Die im Entwurf vorgesehenen Fristsetzungen für Behörden werden einen wichtigen Beitrag hierzu leisten.
Besonders für den Bereich der Geothermie stellt der Gesetzesentwurf einen Meilenstein dar, da diese Technologie mit enormem Potenzial zur Defossilisierung der Wärme- und Kältebereitstellung bisher nicht die notwendige politische Aufmerksamkeit erhalten hat.
Dennoch gibt es in dem Entwurf noch ein gewisses Ausbaupotenzial, um die Chance, die das GeoBG für die Beschleunigung der Wärmewende darstellt, umfassend zu nutzen. So betrachtet der Gesetzentwurf den Bürokratieabbau für den Wärmepumpenausbau vor Allem mit Blick auf oberflächennahe Geothermie und benachteiligt damit weitere technische Varianten der Wärmequellenerschließung. Zwar werden Wärmespeicher im Gesetzestitel benannt, sie werden jedoch im GeoBG zu wenig berücksichtigt, ebenso wie die Aquathermie als Technologie zur Nutzung der Wärmepotenziale unserer Fließgewässer.
Zusätzliche bürokratische Hürden bestehen bei weiteren Technologien der Wärme aus Erneuerbaren Energien, die in diesem Sinne adressiert werden sollten. Detaillierte Ausführungen dieser Ergänzungsvorschläge finden Sie unter “Weitere Maßnahmen für die Beschleunigung der Wärmewende”. Bitte zögern Sie nicht, uns mit Rückfragen zu kontaktieren.
Das Gesetz dient bereits der Erschließung von Quellen im Bereich der Tiefengeothermie, der oberflächennahen Geothermie und der Oberflächengewässer. Zweck und Ziel des Gesetzes sollten daher die Quellenerschließung ausdrücklich benennen. Diese explizite Nennung ist entscheidend, denn häufig geht von diesen Nebenanlagen eine Umweltwirkung aus (Geräusche, Wärme-/Kälteeintrag, Wasserentnahme), die einer Güterabwägung oder einer sonstigen Entscheidung durch eine Verwaltungsbehörde bedarf. Nicht selten sind Quellenanlagen örtlich von der Wärmepumpe getrennt und müssen somit auch getrennt von dieser abgewägt werden.
BEE-Vorschlag:
§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für den vereinfachten und beschleunigten Auf- und Ausbau einer Infrastruktur für die Aufsuchung, Gewinnung und Nutzung von Erdwärme sowie den Ausbau von Wärmepumpen sowie ihrer Quellenanlagen und Wärmespeichern. (…)
Wie bereits ausgeführt, sollte das Gesetz die Quellenerschließung für Wärmepumpen insgesamt umfassen, soweit diese Erneuerbare Energie oder unvermeidbare Abwärme nutzen. Der Verweis auf Bohrungen und Nebenanlagen reicht nicht aus.
In der gegenwärtigen Fassung wären insbesondere Anlagen zur Nutzung von Flusswärme und kalte Nahwärmenetze nicht ausreichend abgedeckt. Für die Flusswärme ist es wichtig, unterschiedliche technische Konstellationen zu beachten, etwa wenn Flusswasser entnommen und einer Wärmepumpe zugeleitet wird.
Beim Versorgungskonzept der kalten Nahwärme bildet das Leitungsnetz nicht nur die Verteilung niedertemperierter Wärme (häufig aus Erdsonden oder Abwasser). Neben der Verteilung sammelt das Leitungsnetz als Kollektor zusätzliche Erdwärme ein. Daher ist es streng genommen nicht als Wärmeleitung, sondern eher als Teil einer geothermischen Anlage zu beachten. Da das kalte Leitungsnetz aber räumlich von der primären Wärmequelle getrennt sein kann, ist auch hier unklar, ob die kalte Nahwärme unter die aufgezählten Teile des Anwendungsbereichs (oder der Nebenanlagen) zählt.
BEE-Vorschlag:
Anwendungsbereich (§ 2 GeoBG)
Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet:
3. einer Wärmepumpe einschließlich der Quellenanlage
Die Begriffsdefinition von Wärmeleitungen schließt nach aktuellem Stand nicht kalte Nahwärmenetze mit ein, da diese meist nicht reines Wasser, sondern ein Glykol-Wasser-Gemisch führen. Dieses Versorgungskonzept ist in Neubauquartieren bereits etabliert und gewinnt auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsquartieren zunehmend an Bedeutung. Über ein Verteilnetz wird niedertemperierte Wärme in einem Quartier bereitgestellt und in den angeschlossenen Gebäuden durch Wärmepumpen angehoben.
BEE-Vorschlag:
5. „Wärmeleitung“ eine Rohrleitungsanlage zur Beförderung von Dampf -oder Warmwasser eines Wärmeträgers zur thermischen Nutzung (Lieferung von Wärme oder Kälte) oder zur Wärmespeicherung
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass Geothermieanlagen und Wärmespeichern ein überragendes öffentliches Interesse zugeordnet wird. Damit schließt das Gesetz auch eine Lücke, da eine entsprechende Beimessung für Güterabwägungen bereits in § 1 Abs. 3 GEG für die Versorgung von Gebäuden postuliert wurde, und nun auch für die Versorgung von Wärmenetzen und Gewerbe/Industrie ergänzt wird. Um diesen Einklang mit dem GEG noch zu erweitern, sollten auch Wärmeleitungen mit einem hohen Anteil Erneuerbarer Energien (≥ 65 %) als im überragenden öffentlichen Interesse liegend aufgenommen werden.
Der BEE schlägt außerdem vor, die Jahreszahl 2045 zu streichen, da die Treibhausgasneutralität das Ziel ausreichend beschreibt und es zu Unsicherheiten führen könnte, falls diese nicht wie geplant bis 2045 erreicht werden sollte.
BEE-Vorschlag:
Die Errichtung, der Betrieb oder die Änderung einer Anlage nach § 2 Nummer 1 bis 4 sowie Wärmeleitungen mit einem Anteil Erneuerbarer Energien von mindestens 65 % liegen bis zum Erreichen der Netto- Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit.
Der BEE begrüßt die Duldungspflicht für Eigentümer und Nutzungsberechtigte von seismischen Explorationen zur Ermittlung des Geothermiepotenzials. Dies wird zu einer erheblichen Erleichterung in der Explorationsphase von Projekten führen und somit den Ausbau von Geothermieanlagen beschleunigen.
In dieser Regelung geht es um die Entnahme von Wasser aus Grundwasser oder Oberflächengewässern (Seen, Flüssen, Hafenbecken) zum Zwecke der Erzeugung von Wärme oder Kälte mittels Wärmepumpen. Das Ansinnen, die Wasserbehörden zu einem beschleunigten Verwaltungsverfahren anzuhalten, ist begrüßenswert.
Ein beschleunigtes Verwaltungsverfahren erscheint weniger für die Errichtung einer Großwärmepumpe relevant (diese ist i.d.R. nicht genehmigungspflichtig), sondern für die Entnahme und Nutzung des Mediums Wasser durch die Quellenanlage einer Wärmepumpe. Dabei sei darauf verwiesen, dass die Begriffsdefinition von Großwärmepumpen unter § 2 GeoBG jedenfalls zu korrigieren ist und es sich eher anbietet, auf die Quellenanlagen von Wärmepumpen im Allgemeinen zu verweisen (s.o.).
Neben der Nutzung von Wärme aus Erneuerbaren Energien ist auch die Kältenutzung aus dem Grundwasser für die Dekarbonisierung unserer Energieversorgung relevant. Deshalb sollte neben dem Heizen mit Grundwasser bzw. Erdwärme auch das Kühlen mit Grundwasser bzw. Erdwärme erleichtert werden.
Um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung weiter voranzubringen, wird vorgeschlagen, neben der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für die oberflächennahe und die Tiefen-Geothermie auch die Beschleunigung von Genehmigungen weiterer Optionen Erneuerbarer Wärmeversorgung zu nutzen. Dazu sollte der Gesetzentwurf des GeoBG um die o. a. Regelungen zur Genehmigungserleichterung für die Aquathermie ergänzt werden.
Die Nutzung von Flusswärme bietet signifikante Potenziale, sowohl für das Gelingen der Wärmewende als auch zur Verbesserung der Gewässerökologie. Die großen Chancen dieser Technologie sollten genutzt und gefördert werden. Weitere Informationen finden Sie auch in der Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW).
BEE-Vorschlag:
In § 11a WHG Abs. (1) wird in Satz 1 Nr. 2 die folgende Ergänzung vorgenommen:
“2. Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von Flusswärme und Erdwärme, wenn ein bergrechtlicher Betriebsplan nicht erforderlich ist.”
In § 36 WHG wird nach Abs. (1) folgender neuer Satz 4 angefügt:
„4. Die Entnahme- und Wiedereinleitungsbauwerke zur Gewinnung von Flusswärme, die gleichzeitig auch zu einer Abkühlung des Gewässers beitragen.“
In § 36 WHG wird nach Abs. (3) folgender neuer Abs. (4) angefügt:
„(4) Entnahme- und Wiedereinleitungen zum Zwecke der Flusswärmegewinnung, die gleichzeitig zur gewässerökologisch gewünschten Abkühlung des Gewässers beitragen, sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Steht die Flusswärmegewinnung und Gewässerabkühlung in Verbindung mit einer bestehenden Gewässerbenutzung, so ist keine gesonderte Genehmigung erforderlich.“
§ 46 Absatz 1 Satz 1wird wie folgt geändert
In Nummer 1 wird nach der Angabe „Haushalt“ die Angaben „inklusive Wärme- und/oder Kälteversorgung über den Entzug und die Einleitung von Wärme aus dem Wasser“ eingefügt.
Wärmespeicher haben bei der Nutzung von Erneuerbaren Energien in vielerlei Hinsicht eine besondere Bedeutung, nicht nur im Zusammenhang mit der Nutzung von Umweltwärme und Tiefengeothermie. Auch bei anderen Erneuerbaren Energien gibt es regulatorische Hürden für die Errichtung von Wärmespeichern, die mit dem GeoBG adressiert werden sollten.
Solarthermie bietet CO2-freie Wärme bis 400° C. Sie kann damit weite Teile der Industrie mit Prozesswärme versorgen und bietet als Bestandteil eines Wärmenetzes dauerhaft günstige und planbare Energie. Um die Verfügbarkeit der Wärme bei begrenzter Zahl an Sonnenstunden zu erhöhen, ist die Integration von Wärmespeichern essentiell. Wärmespeicher werden dabei als Leistungsspeicher für kurzfristige Einspeicherung von überschüssiger Leistung oder als Energiespeicher für längerfristige Speicherung von Wärme eingesetzt. Dazu sind je nach Bedarfsprofil und Deckungsgrad entweder Tages-, Mehrtages- oder Saisonalspeicher mit dem Solarfeld verbunden. Dank der Integration von Wärmespeichern kann ein hoher solarer Deckungsgrad von bis zu 75 % erreicht werden.
Flexible Bioenergieanlagen sind ein hervorragendes dezentrales Back-Up für den Ausgleich der Schwankungen der Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie. Die meisten Bioenergieanlagen laufen jedoch in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), d.h. sie produzieren neben Strom auch Wärme. Damit Bioenergieanlagen ihre Stromerzeugung flexibel an die Stromeinspeisung von Wind- und Solaranlagen anpassen und gleichzeitig die Wärmeversorgung aufrechterhalten können, müssen Strom- und Wärmeerzeugung zeitlich entkoppelt werden. Diese Funktion erfüllen Wärmespeicher. Im Bereich der Biogas-KWK gibt es jedoch regulatorische Hemmnisse für die Errichtung von Wärmespeichern und damit für die Flexibilisierung von Biogasanlagen, die mit dem GeoBG adressiert werden sollten.
Wärmeverbraucher liegen im Normalfall nicht unmittelbar am Standort der Biogasanlage. Um Biogas effizienter zur Wärmeversorgung nutzen zu können, werden Biogas-BHKW deshalb öfter vom Standort der Biogaserzeugung abgesetzt und am Standort des jeweiligen Wärmeverbrauchers oder eines Nahwärmenetzes errichtet (so genannte „Satelliten-BHKW“). Das Biogas wird dann über eine Rohrbiogasleitung von der Biogaserzeugungsanlage zum Satelliten-BHKW transportiert.
Der Privilegierungstatbestand für Biomasseanlagen in § 35 Abs. 1 Nr. 6 Baugesetz (BauGB) ermöglicht die Errichtung solcher Satelliten-BHKW im Außenbereich nicht. Mit der am 01. Januar 2024 in Kraft getretenen Sonderregel in § 246d Abs. 4 Nr. 2 BauGB soll diese regulatorische Lücke beseitigt und die Errichtung von Satelliten-BHKW im Außenbereich ermöglicht werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auch in der Stellungnahme des Hauptstadtbüro Bioenergie zur laufenden BauGB-Novelle.
Um die Wärmewende und den Ausbau der Solarthermie zu beschleunigen sowie die grundlegenden Zielsetzungen – Flexibilisierung der Stromerzeugung aus Biogas und Wärmewende – zu vereinen, bedarf es jedoch eines weiteren Schrittes, denn der Wärmespeicher, der für die Flexibilisierung des Satelliten-BHKWs und für das volle Ausschöpfen des Solarthermie-Potenzials notwendig wäre – kann aktuell nicht privilegiert im Außenbereich errichtet werden.
BEE-Vorschlag:
Mit dem GeoBG sollte ein neuer Privilegierungstatbestand für Behälter- und ggf. auch für kleine Erdbecken-Wärmespeicher in § 35 BauGB eingeführt werden.
Die Privilegierung von Tiefengeothermievorhaben im bauplanungsrechtlichen Außenbereich wird zwar in der Praxis und von der Rechtsprechung meist bejaht, sie kann aber im Einzelfall immer noch in Zweifel gezogen werden. Hier sollte durch einen besonderen gesetzlichen Privilegierungstatbestand für die Geothermie klargestellt werden, dass die Nutzung der Erdwärme im Außenbereich genauso wie die Nutzung der Windkraft bauplanungsrechtlich privilegiert ist.
Neben der Geothermie ist die Solarthermie eine weitere Technologie, die ohne Brennstoff und mit minimalem Stromeinsatz für die Anlagen auskommt. Auch sie liefert jahrzehntelang Wärme, die keinen Preisschwankungen und Lieferengpässen unterliegt.
Im Außenbereich sind Solarthermieanlagen bisher nur als Anlagen in, an oder auf Gebäuden oder längst von Autobahnen und bestimmten Schienenwegen privilegiert. Der dafür maßgebliche § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB gilt für Solaranlagen sowohl zur Wärme- als auch zur Stromerzeugung. Weitere Freiflächen-Solaranlagen werden als Agri-Photovoltaikanlagen durch Nr. 9 nur dann privilegiert, wenn sie der Stromerzeugung dienen. Für die dringend anstehende Transformation der Wärmeerzeugung, insbesondere für die Versorgung größerer Wärmeverbraucher (Wärme- und Gebäudenetze, Industrie- und Gewerbebetriebe), muss auch das Potenzial von Freiflächen-Solarthermieanlagen kurzfristig erschlossen werden. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur treibhausgasneutralen Wärmeerzeugung leisten.
Anders als bei solaren Stromerzeugungsanlagen kann die erzeugte Energie bei Freiflächen-Solarthermieanlagen nicht über große Entfernungen transportiert werden, sondern muss in der Nähe der Erzeugungsanlage verbraucht werden. Der Transport von Wärme ist deutlich kostenintensiver als der von Strom. Den Besonderheiten von Freiflächen-Solarthermieanlagen soll daher durch einen zusätzlichen Privilegierungstatbestand Rechnung getragen werden.
Die Privilegierung soll dann greifen, wenn ihre Errichtung den Ausweisungen der kommunalen Wärmeplanung entspricht oder wenn ein bestehender bzw. in Vorbereitung befindlicher kommunaler Wärmeplan dem Vorhaben nicht entgegensteht.
BEE-Vorschlag:
Solarthermieanlagen für Gebäude- und Wärmenetze sowie zur Versorgung von Industrie und Gewerbe sollten ebenfalls in § 35 BauGB privilegiert werden, wenn sie der jeweiligen kommunalen Wärmeplanung entsprechen bzw. dieser nicht entgegenstehen.
Einen konkreten Formulierungsvorschlag hat der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW) in seiner Stellungnahme unterbreitet.
Verbändeappell an die Bundesregierung
Empfehlungspapier zur Wärmepolitik in der neuen Legislatur