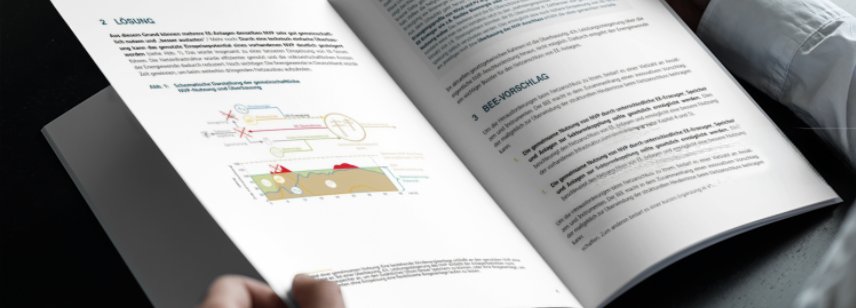
Die vom Bundeskabinett am 1. Oktober 2025 beschlossene Modernisierungsagenda unterstreicht die Bedeutung eines Staates, der zügig…
23. Oktober 2025
Die vom Bundeskabinett am 1. Oktober 2025 beschlossene Modernisierungsagenda unterstreicht die Bedeutung eines Staates, der zügig entscheidet, Bürokratie zurückbaut und für breite Entlastung sorgt. Ziel ist es, Verfahren zu vereinfachen, Verwaltungskapazitäten gezielter einzusetzen und Kosten sowohl für den Staat als auch für Unternehmen und Haushalte zu reduzieren.
Gerade beim Ausbau der Erneuerbaren Energien zeigt sich, wie stark komplexe und langwierige Verfahren zu bürokratischen Hemmnissen führen. Planungs- und Genehmigungsprozesse erhöhen den Aufwand für Projektträger, verzögern dringend notwendige Investitionen und sorgen damit in vielen Fällen für Engpässe bei der Transformation des Energiesystems. Ein „spürbarer Bürokratieabbau“, wie er in der Modernisierungsagenda vorgesehen ist, leistet daher nicht nur einen Beitrag zur Staatsmodernisierung, sondern senkt zugleich die Systemkosten, beschleunigt die Energiewende und sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland für die Erneuerbare-Energien-Branche.
Als Dachverband und Repräsentant dieser Branche sieht der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE) in der konsequenten Vereinfachung von Vorschriften und Prozessen einen entscheidenden Hebel, um Verwaltungsstrukturen zu entlasten, marktwirtschaftliche Mechanismen stärker wirken zu lassen und die Energiewende als gesamtgesellschaftliches Projekt effizienter zu gestalten.
Mit dem vorliegenden Papier unterbreitet der BEE konkrete Vorschläge für die Sektoren Strom und Wärme. Die Maßnahmen zeigen auf, wie durch gezielte regulatorische Anpassungen Verfahren beschleunigt, Genehmigungsprozesse verschlankt und Kosten gesenkt werden können. Das Papier versteht sich als konstruktiver Beitrag zur Ausgestaltung des spürbaren Bürokratieabbaus im Rahmen der Modernisierungsagenda der Bundesregierung. Die Umsetzung sollte im engen Austausch mit Politik, Verwaltung und Praxis möglich sein. Die Maßnahmen sollen ein zukunftsfähiges, effizientes und sicheres Erneuerbares Energiesystem pragmatisch und wirksam unterstützen.
» Wind: 8,7 GW fertig geplante Windenergieprojekte hängen aktuell in Genehmigungsverfahren und Repowering bietet Potenzial von 45 GW über die nächsten drei Jahre. Angesichts dieses Genehmigungsstaus sind die Prüfumfänge, insbesondere im Artenschutzrecht, zu entschlacken und weiter zu standardisieren. Dem überragenden öffentlichen Interesse an den Erneuerbaren Energien (EE) muss vollends Rechnung getragen werden. Durch weitere bauplanungsrechtliche Anpassungen, vor allem im Baugesetzbuch, sollten auch die Ausweisungen von Flächen beschleunigt werden. Zudem ist auch hier die zügige und pragmatische Umsetzung der dritten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED-III) unerlässlich, um das volle Beschleunigungspotenzial zu nutzen. Die Länder sind aufgefordert, die Gesetzesnovellen des letzten Jahres zügig in die Praxis umzusetzen.
» Photovoltaik und Solarthermie: Die Genehmigungsverfahren für Solaranlagen sollten beschleunigt werden. Zudem sollte der Netzanschlussprozess von Photovoltaikanlagen erleichtert und entbürokratisiert werden. Zur Beschleunigung sollte eine baurechtliche Privilegierung für Batteriespeicher, Solarthermieanlagen im Außenbereich (u. a. zur Fernwärmeversorgung) sowie Agri-PV-Anlagen eingeführt werden. Die zunehmende Kosten- und Bürokratiebelastung durch Landesbeteiligungsgesetze, naturschutzfachliche Vorgaben u. ä. sollte reduziert werden. Zudem sollten steuerliche Hemmnisse im Kontext der Flächenzuweisung (Erbschaftssteuer, Grundsteuer) gelöst werden.
» Wasserkraft: Das in § 2 EEG festgeschriebene überragende öffentliche Interesse an der Erneuerbaren Energieerzeugung muss in weitere Fachgesetze, wie das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), überführt werden, damit diese Regelung im behördlichen Abwägungsprozess Wirkung entfalten kann. Weiterhin sind wasserrechtliche Genehmigungsverfahren durch standardisierte, digitalisierte Verfahren mit verkürzten Entscheidungsfristen, der Einführung einer Vollständigkeitsfiktion etc. zu vereinfachen und zu beschleunigen. Um die großen Potenziale der Flusswärme nutzen zu können, sind bisher fehlende Definitionen und Verfahrensregelungen im Geothermie-Beschleunigungsgesetz (GeoBG) bzw. im WHG zu berücksichtigen.
» Bioenergie (Biogas, Holzenergie, Biokraftstoffe): Eine praxisgerechte Ausgestaltung und Vereinfachung von Zertifizierungs- und Nachweispflichten sowie genehmigungs- und baurechtliche Erleichterungen für Neu- und Bestandsanlagen können Investitionen in die Umrüstung des Anlagenparks auf eine flexible Strom- und Wärmeerzeugung, eine effiziente Biomethannutzung sowie den Anlagenbetrieb insgesamt erleichtern. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Gase und die dazugehörige Infrastruktur sollten als im überragenden öffentlichen Interesse anerkannt werden.
» Netzausbau und -anschlüsse für Strom, Gas, Wasserstoff und Wärme: Gesetzliche Vereinfachungen für den dringend notwendigen Netzausbau umfassen zunächst eine Duldungspflicht für den Bau von Kabeltrassen zwischen Energieanlagen und Netzanschlusspunkten. Weiterer Handlungsbedarf besteht in einer Optimierung von Netznutzung und -betrieb sowie durch den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur, von dem auch die Industrie profitieren kann. Die Ende 2025 auslaufenden Regelungen für den Anschluss von Biomethananlagen und Elektrolyseuren ans Gasnetz (GasNZV) – insbesondere zur Aufteilung der Netzanschlusskosten – sollten verlängert werden. Eine darauffolgende, unbürokratische Anschlussregelung ist dringend notwendig.
Die Ausweisung von verfügbaren Flächen ist eine zwingend erforderliche Voraussetzung für den Ausbau Erneuerbarer Energien, gestaltet sich jedoch oft als langwieriger Prozess, für den etliche Behördengänge mit langen Bearbeitungszeiten notwendig sind. Zur letzten Novelle des BauGB aus dem Jahr 2024 hat der BEE bereits eine Reihe von Anmerkungen in einer Stellungnahme zusammengefasst. Im Folgenden stellt der Verband die Vorschläge nun noch einmal technologiespezifisch dar.
Während die dazugehörigen Ausschreibungen wiederholt weit überzeichnet sind, liegt der Ausbau von Wind an Land im Jahr 2025 noch immer hinter den Zielen des EEG. Der Schlüssel, um den Ausbau von Wind an Land zu beschleunigen, liegt in der Verkürzung von Genehmigungsverfahren. Details zu möglichen Änderungen am BauGB finden in der Stellungnahme des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE) aus dem August 2023. Ergänzend dazu hat der BEE die folgenden Empfehlungen zusammengetragen:
» Streichung der Grundzüge der Planung: § 245e Abs. 3 BauGB bzw. § 249 Abs. 3 BauGB enthalten zusätzliche Erleichterungen für das Repowering von Bestandsanlagen. Im Falle des § 245e Abs. 3 BauGB steht diese Sonderregelung unter dem Vorbehalt, dass die Grundzüge der Planung durch die Zulassung des Repowering-Vorhabens nicht berührt werden dürfen. Da die Auslegung des Begriffs der „Grundzüge der Planung“ in der Praxis für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgt, spricht sich der BEE für eine Streichung aus.
» Länderabstandsklauseln abschaffen: Pauschale Länderabstandsklauseln als künstliche Flächenbeschränkung großen Ausmaßes sollten abgeschafft werden.
» Gemeinde-Öffnungsklausel: Mit einer Gemeinde-Öffnungsklausel ließe sich angesichts bestehender Unsicherheiten langfristig eine schnellere Planung ermöglichen, die unabhängig ist von der Flächenzielverteilung, den Länderabstandsklauseln und der Ausschlusswirkung von Regionalplänen.
» Behindernde Plansicherungsinstrumente sind auszusetzen und § 245e Abs. 2
zu streichen.
» Entgegenstehende Bauleitplanungen sind bis zu ihrer Anpassung auszusetzen.
» Eine Rotor-Out-Regelung muss gesetzlich verbindlich gemacht werden.
» Die Festschreibung des Abwägungsvorrangs (§ 2 EEG 2021 n. F.) sollte in sämtlichen Fachgesetzen verankert werden.
Denkmalschutz auf raumordnerischer und bauleitplanerischer Ebene abwägen
Ziel muss es sein, dass die denkmalrechtlichen Belange abschließend auf der planerischen Ebene, welche für die Ausweisung von Windenergieflächen zuständig ist, unter Beachtung des Vorrangs gemäß § 2 EEG abgearbeitet werden. Dann könnten sie im Genehmigungsverfahren nicht mehr zur Ablehnung von Windenergieanlagen führen, weil eine abschließende Entscheidung auf der Planebene getroffen wurde. Dazu können Regelungen im BauGB und im Raumordnungsgesetz festgelegt werden. Detaillierte Vorschläge dazu finden sich im BWE-Positionspapier „Lösung der Blockade von Windenergieprojekten durch Denkmalschutz“.
Baurechtliche Privilegierung für Batteriespeicher, Solarthermie und Agri-PV-Anlagen einführen
Für eine kostengünstige, von Erneuerbaren Energien getragene und zuverlässige Stromversorgung müssen in großem Umfang Flexibilitäten geschaffen werden, insbesondere durch den schnellen Zubau von Batteriespeichern. Auch der Koalitionsvertrag erkennt die Notwendigkeit von Speichern sowie einer Ausweitung ihrer baurechtlichen Privilegierung an. Diese Klarstellung ist für den energiewirtschaftlich dringend notwendigen Booster beim Zubau von Batteriespeicherkapazitäten unerlässlich. Dies gilt insbesondere beim Speicherzubau neben baurechtlich privilegierten PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sowie neben bestehenden PV-FFA.
Die Dauer und Komplexität von Genehmigungsverfahren für PV-FFA stellen zunehmend ein Hemmnis für den notwendigen Hochlauf des Ausbaus von Freiflächen-PV dar. Gleichzeitig ist die Durchführung eines kommunalen Bebauungsplanverfahrens eine wichtige Stütze für die lokale Akzeptanz. Eine baurechtliche Privilegierung sollte deshalb für Projekte eingeführt werden, wo die hauptsächliche Nutzung der Fläche beibehalten wird (Agri-PV-Anlagen) oder bei denen der bürokratische Aufwand der kommunalen Bauleitplanung unverhältnismäßig ist (kleine PV-FFA bis 1 MW und bereits planfestgestellte Flächen).
Im Wärmebereich sollten leitungsgebundene Solarthermie-FFA für Gebäude- und Wärmenetze sowie zur Versorgung von Industrie und Gewerbe nach § 35 BauGB privilegiert werden. Die fehlende Privilegierung und daraus resultierende langwierige Genehmigungsprozesse sind aktuell der entscheidende Hinderungsfaktor dieser Technologie.
BEE-Vorschlag: Eine baurechtliche Privilegierung in § 35 BauGB sollte eingeführt werden
» zum Hochlauf von Batteriespeichern (neben Bestands-PV-FFA, privilegierten PV-FFA)
» zur Beschleunigung der Wärmewende (Solarthermie-FFA)
» bei Beibehaltung der bisherigen Flächennutzung (Agri-PV)
» zur Entbürokratisierung (kleine PV-Anlagen bis 1 MW, PV-Anlagen auf bereits planfestgestellten Flächen)
Zusätzlich zum BauGB sind weitere Genehmigungserleichterungen bei Solaranlagen notwendig. Hier hat der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW Solar) bereits Vorschläge entwickelt.
Geothermie in § 35 BauGB aufnehmen
Eine Verankerung der Privilegierung von Erdwärme fehlt bislang in § 35 BauGB. Zwar wird eine Privilegierung von Geothermieanlagen als ortsgebundener gewerblicher Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB sowohl in der Praxis als auch von Gerichten häufig anerkannt, doch kommt es häufig zu Verzögerungen. Das gilt insbesondere, wenn die Bergbehörde der Privilegierung der Gewinnungsanlage (beginnend mit dem Bohrplatz) zustimmt, die Bauaufsicht die Privilegierung für die erforderliche Heizzentrale jedoch ablehnt. Daher würde eine Aufnahme von Geothermieanlagen ins BauGB die Planung erheblich beschleunigen. Details finden sich im Positionspapier des Bundesverbands Geothermie (BVG) auf Seite 5.
BEE-Vorschlag: Die Erdwärme sollte in die Liste privilegierter Vorhaben in § 35 BauGB aufgenommen werden, um die Planungsphase für Geothermieanlagen deutlich zu beschleunigen. Der BEE schlägt vor, in § 35 Abs. 1 um die Worte „oder der Erdwärme” zu ergänzen.
Behälterwärmespeicher und kleinere Erdbeckenspeicher
Wärmespeichern kommen bei der Nutzung von Erneuerbaren Energien in vielerlei Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. Die Integration von Wärmespeichern ist essenziell, um beispielsweise die Verfügbarkeit der Wärme aus Solarthermie bei einer begrenzten Zahl an Sonnenstunden zu erhöhen. Darüber hinaus sind Wärmespeicher notwendig, damit Biogas- und andere KWK-Anlagen ihre Stromerzeugung flexibel an die Stromeinspeisung von Wind- und Solaranlagen anpassen und gleichzeitig die Wärmeversorgung aufrechterhalten können, da dafür die Strom- und die Wärmeerzeugung zeitlich entkoppelt werden muss. Der BEE schlägt deshalb vor, Wärmespeicher in die Liste privilegierter Vorhaben aufzunehmen.
Clusternde Biogasaufbereitungsanlagen und Satelliten-BHKW
Die Errichtung von Biogasaufbereitungsanlagen, die das Biogas mehrerer Biogasanlagen bündeln („clustern“), bzw. von Biogas-BHKW, die vom Standort der Biogaserzeugung abgesetzt an einer Wärmesenke errichtet werden („Satelliten-BHKW“), soll mit den Sonderregeln in § 246d Absatz 4 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB im Außenbereich ermöglicht werden. Allerdings ist die Regelung zu clusternden Biogasaufbereitungsanlagen unnötig restriktiv, da Biogasanlagen ausgeschlossen werden, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder im unbeplanten Innenbereich errichtet bzw. betrieben werden. Bei der Regelung zu den Satelliten-BHKW ist der Anknüpfungspunkt – die Biogaserzeugungsanlage – falsch gewählt, weshalb die Regelung in der Praxis nicht angewendet werden kann. Der BEE schlägt daher vor, die unnötigen Restriktionen zu clusternden Biogasaufbereitungsanlagen (sofern nicht bereits privilegiert) zu streichen und die Regelungen zu Satelliten-BHKW praxisnäher auszugestalten.
Beschleunigung für die ganze Wasserstoffwertschöpfungskette
Im Entwurf des Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes werden unter anderem Elektrolyseure als im überragenden öffentlichen Interesse liegend eingestuft. Wichtig ist, dass auch biogener Wasserstoff von der rechtlichen Privilegierung profitiert.
Darüber hinaus empfiehlt der BEE eine Überarbeitung der §§ 35, 249a BauGB. § 249a BauGB enthält bereits Sonderregelungen zu § 35 BauGB über die Zulässigkeit von Vorhaben für die Herstellung und Speicherung von Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien. Innerhalb der aktuellen baurechtlichen Vorgaben, insbesondere der Flächenbegrenzung auf 100 Quadratmeter sowie der maximal zulässigen Höhe von 3,5 Metern, ist ein sinnvoller Ausbau von Wasserstoffspeichern jedoch nicht möglich. Der Gesetzgeber hat hier für Wasserstoffspeicher, die als privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35 BauGB eingestuft werden, Normen festgelegt, die die praktische Umsetzung von Wasserstoffprojekten erheblich einschränken.
Der BEE regt daher an, § 35 Abs. 1 BauGB so zu ergänzen, dass Wasserstoffprojekte als privilegierte Vorhaben im Außenbereich anerkannt werden. Zudem schlägt der Verband eine grundlegende Überarbeitung bzw. Neufassung von § 249a BauGB vor, um die baurechtlichen Rahmenbedingungen an die tatsächlichen Erfordernisse einer sinnvollen Wasserstoffproduktion anzupassen.
BEE-Vorschlag: In § 35 Abs. 1 BauGB ist eine neue Nummer 11 wie folgt zu ergänzen (neuer Text in Rot):
„Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es […]
11. der Umwandlung von elektrischer Energie in Wasserstoff nach Maßgabe des § 249a dient.“
Neufassung des § 249a BauGB (neuer Text in Rot):
„(1) Ein Vorhaben, das der Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff dient, ist nach Maßgabe des § 35 Absatz 1 Nummer 11 und unter den in Absatz 2 genannten weiteren Voraussetzungen im Außenbereich privilegiert, wenn es in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit
a) einer Anlage zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 oder
b) einer Anlage zur Nutzung solarer Strahlungsenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b oder Nummer 9 oder
c) einer sonstigen Anlage zur Nutzung solarer Strahlungsenergie oder d) einem Umspannwerk steht.
(2) Ein Vorhaben ist nach Absatz 1 nur zulässig, wenn
a) durch technische Vorkehrungen sichergestellt ist, dass der Wasserstoff ausschließlich aus dem Strom der in Absatz 1 a bis c genannten Anlagen oder ergänzend dazu aus dem Strom sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien erzeugt wird,
b) die Produktionskapazität nicht mehr als 50 Tonnen Wasserstoff pro Tag beträgt und der Höhenunterschied zwischen der Geländeoberfläche im Mittel und dem höchsten Punkt der baulichen Anlagen 10 Meter nicht überschreitet, und
c) die in Absatz 1 genannte Anlage oder die sonstigen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien nach Nummer 1 nicht bereits mit einem anderen Vorhaben zur Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff verbunden sind.“
(3) bis (5) entfallen.
Die geplante Ergänzung in § 4 Abs. 1 Satz 5 WindBG soll klarstellen, dass Flächen mit genehmigungsbedingten Höhenbegrenzungen auf das Flächenziel angerechnet werden können, nicht jedoch Flächen mit planerisch festgelegten Höhenbeschränkungen. Diese Unterscheidung entspricht der geltenden Rechtslage und wird durch die Auslegungshilfe sowie die Vollzugshilfe zum WindBG bestätigt. Eine gesetzliche Klarstellung ist daher nicht erforderlich. Stattdessen sollte gesetzlich festgeschrieben werden, dass nur wirtschaftlich nutzbare Flächen angerechnet werden dürfen. Andernfalls werden die Flächenziele unterlaufen und der Ausbau der Windenergie gefährdet.
Die Anpassung von § 6b Abs. 2 Satz 2 WindBG an europarechtliche Vorgaben ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Sie stellt klar, dass bestimmte Prüfungen in sogenannten Beschleunigungsgebieten entfallen und nur dann im Rahmen der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) berücksichtigt werden müssen, wenn dies zwingend erforderlich ist. Allerdings führt die unbestimmte Formulierung „soweit zwingend erforderlich“ zu rechtlicher Unsicherheit und kann Behörden dazu verleiten, aus Vorsicht weiterhin umfassende Prüfungen anzuordnen. Auch wenn dies in der Praxis bisher nur selten vorkam, besteht mit der aktuellen Gesetzesfassung die Gefahr, dass solche Anforderungen häufiger werden. Der BEE sieht deshalb die Notwendigkeit, in der Begründung klarzustellen, dass sich die Eingriffsregelung ausschließlich auf die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und auf das Landschaftsbild bezieht. Einzelne Arten sind in diesem Rahmen nicht zu berücksichtigen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass über diese Eingriffsregelung aufwändige und teure artenschutzrechtliche Untersuchungen eingefordert werden, die zu erheblichen Verzögerungen in Genehmigungsverfahren führen können.
BEE-Vorschlag: Nach Ansicht des BEE braucht es eine Klarstellung, dass vertiefende Prüfungen für die Abarbeitung der Eingriffsregelung nicht erforderlich sind. Sollte dies keine Option sein, schlägt der Verband als Alternative vor, die Intention aus der Gesetzesbegründung zumindest in Form einer Regelvermutung zu hinterlegen, indem § 6b Absatz 1 Satz WindBG (Reg-E) angepasst wird (neuer Text in Rot):
„Inhalte der Prüfungen, die nach Satz 1 Nummer 2 und 3 nicht zu prüfen sind, sind bei der Anwendung der §§ 13 bis 17 des Bundesnaturschutzgesetzes nur zu berücksichtigen, soweit dies zur Ermittlung und zur Bewertung eines Eingriffs in Natur und Landschaft zwingend nicht zulässig ist.“
Zunächst ist zu betonen, dass in der Genehmigungsfiktion eine erhebliche Chance der Verfahrensbeschleunigung gesehen wird. Der BEE regt daher an, die Möglichkeiten der RED III vollumfänglich zu nutzen und die Genehmigungsfiktion umzusetzen.
Die Genehmigungsfiktion auch dann nicht aufzunehmen, wenn bereits ein positives Screening erfolgt ist, widerspricht dem Wortlaut von Artikel 16a Absatz 5 sowie Erwägungsgrund 35 der RED III. Demnach sollen Projekte nach einem positiven Screening als genehmigt gelten, ohne dass eine weitere behördliche Entscheidung erforderlich ist. Unklar bleibt zudem, welche Rechtsfolgen die in der RED III vorgesehene Frist von 45 Tagen für das Screening ohne eine entsprechende Genehmigungsfiktion überhaupt haben soll.
Der BEE empfiehlt daher, den Wortlaut zu verwenden, nach dem bestimmte Anforderungen „als eingehalten gelten“. Diese Formulierung entspricht dem europäischen Rechtssystem und lässt eine Widerlegung in besonderen Einzelfällen zu. Sollte diese Formulierung als zu weitgehend bewertet werden, wäre eine abgeschwächte Variante denkbar, wie sie etwa in § 45b Absatz 3 Nummer 2 BNatSchG enthalten ist. Diese stellt klar, dass es sich um eine Regelvermutung handelt, die jedoch materielle Rechtswirkung entfaltet.
Für den Fall, dass Bedenken hinsichtlich der Investitionssicherheit durch mögliche Drittanfechtungen bestehen, schlägt der BEE vor, eine zusätzliche Regelung in § 6b Absatz 4 WindBG aufzunehmen. Diese sollte sicherstellen, dass die Genehmigungsbehörde im Falle eines Drittwiderspruchs oder einer Klage nachträglich zum Screening fristgebunden eine Begründung nachreichen muss. Dies erhöht die Rechtssicherheit, da Gerichte oder Widerspruchsbehörden eine fundierte Entscheidungsgrundlage erhalten.
BEE-Vorschlag: Folgende ergänzende Sätze 7 und 8 nach § 6b Absatz 4 Satz 6 WindBG (Reg-E) anfügen:
„Trifft die zuständige Behörde im Überprüfungsverfahren nach Absatz 2 innerhalb der Frist nach Absatz Satz 1 keine begründete Entscheidung darüber, ob höchstwahrscheinlich Auswirkungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 5 zu erwarten sind, die nicht durch Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 gemindert werden können, ist in der Regel davon auszugehen, dass die Vorschriften nach §§ 34 und 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 27 des Wasserhaushaltsgesetzes eingehalten sind. Legt ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen die Genehmigung ein, hat die zuständige Behörde binnen 30 Tagen nach Kenntnis von dem Rechtsbehelf die begründete Entscheidung nach Satz 1 auszuformulieren und der für den Rechtsbehelf zuständigen Behörde sowie dem Träger des Vorhabens zuzuleiten.“
CO₂-Abscheidungsanlagen im BImSchG rechtssicher einordnen
Erste Genehmigungsverfahren zur Erweiterung von Biomasseheizkraftwerken um CO₂-Abscheidungsanlagen zeigen erheblichen Klärungsbedarf im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Aufgrund fehlender Erfahrungswerte besteht in den Genehmigungsbehörden Unsicherheit über die rechtliche Einordnung dieser Technologie. In der Praxis wurden Vorhaben, die im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG beantragt wurden, teilweise als vollständige Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG eingestuft, was die Genehmigungsdauer um mehrere Monate verlängerte. Diese Fälle verdeutlichen die Notwendigkeit einer rechtlichen Präzisierung.
Um Planungssicherheit zu gewährleisten und Verfahren zu beschleunigen, sollte das BImSchG um klare Definitionen von CO₂-Abscheidungsanlagen ergänzt werden. Abscheidungsanlagen für Kohlenstoffdioxid sind keine eigenständigen Anlagen im Sinne von Nr. 10.3.2.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung), da sie ausschließlich in Verbindung mit der Hauptanlage betrieben werden und deren Abgase behandeln. Sie sind daher als Nebenanlagen einzuordnen. Zudem handelt es sich bei CO₂ nicht um einen klassischen Schadstoff mit toxischen Eigenschaften, sondern um einen natürlichen Bestandteil der Luft. Eine Einstufung unter Nr. 10.3 der 4. BImSchV ist daher nicht sachgerecht.
Auch bei Abscheideverfahren wie der Aminwäsche besteht Regelungsbedarf, da geringe Mengen von Aminen oder Ammoniak in das Rauchgas übergehen können. Dafür existieren bislang jedoch keine gesetzlich festgelegten Emissionsgrenzwerte. Derzeit bestehen solche Vorgaben nur für Anlagen mit SCR- oder SNCR-Technologie zur Stickstoffoxidminderung.
BEE-Vorschlag: Im BImSchG sollte eindeutig definiert werden, wie Anlagenbestandteile zu behandeln sind, die ausschließlich der CO₂-Abscheidung dienen und hierfür genehmigt sowie betrieben werden. Da CO₂-Abscheidungsanlagen ausschließlich in Verbindung mit der Hauptanlage betrieben werden können, wäre eine Einordnung als Nebenanlage zutreffend. Dies würde zu mehr rechtlicher Klarheit beitragen, die zuständigen Behörden entlasten und Genehmigungsprozesse beschleunigen. Im BImSchG sollte darüber hinaus klar geregelt werden, wie die Emissionen des CO₂-reduzierten Rauchgases rechtlich einzuordnen sind und ob dafür spezifische Emissionsgrenzwerte gelten. Falls solche Grenzwerte erforderlich sind, müssten diese noch verbindlich festgelegt werden.
Durch Standardisierung zur Vereinfachung bei Artenschutzauflagen beitragen
Die letzte Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) hat die artenschutzrechtliche Standardisierung vorangebracht. Jedoch fehlt weiterhin ein angemessenes Instrument zur Signifikanzbewertung und einzelne Regelungen weisen Nachbesserungsbedarf auf, insbesondere im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen der Anlage 1 zu § 45b BNatSchG. Eine weitergehende Standardisierung könnte die Komplexität deutlich verringern, die Anforderungen für Unternehmen klarer fassen und so wesentlich zur Vereinfachung und Entbürokratisierung artenschutzrechtlicher Verfahren beitragen (siehe BWE-Stellungnahme aus dem Juni 2022).
Zur zügigen Umsetzung des BNatschG in den Ländern sollten die Landesministerien ihre Behörden unterstützen. Dazu müssen Leitfäden und Erlasse umgehend angepasst, offene Fragen geklärt und klare Regelungen entsprechend den Zielen des Bundesgesetzes geschaffen werden, um Verfahren und Genehmigungen zu vereinfachen und zu beschleunigen.
BEE-Vorschlag: Damit die Regelungen des § 45b BNatSchG ihre volle Beschleunigungswirkung entfalten können, bedarf es einer fachlich fundierten und praxistauglichen Methode zur Signifikanzbewertung. Der BEE empfiehlt, die Probabilistik als standardisiertes Instrument zur Signifikanzbestimmung in das BNatSchG aufzunehmen.
Für das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sowie Abschaltauflagen zum Schutz von Fledermäusen braucht es eine bundesweit einheitliche Regelung, um Klarheit für Genehmigungsverfahren zu erhalten – analog zum bundeseinheitlich geregelten Schutz von kollisionsgefährdeten Brutvogelarten.
Seismische Messungen nicht als Eingriff definieren
Seismische Messungen sind notwendig, um das geothermische Potenzial an einem Standort näher zu bestimmen. Sie stehen am Anfang eines jeden tiefengeothermischen Projekts. Die dabei verursachten Geräusche und Vibrationen sind von kurzer Dauer und in ihrer Intensität so unerheblich, dass eine mutwillige Beunruhigung wildlebender Tiere im Sinne der allgemeinen artenschutzrechtlichen Regelungen des § 39 BNatSchG nicht gegeben ist. Dasselbe gilt auch in Bezug auf die Störung besonders geschützter Tierarten im Sinne der Regelung des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG. Insgesamt gehen die Auswirkungen einer seismischen Exploration auf wilde Tiere und Pflanzen nicht über die Auswirkungen des LKW-Verkehrs oder von Maschinen der Land- oder Forstwirtschaft hinaus. Diese werden naturschutzrechtlich ebenfalls als unerheblich eingestuft.
BEE-Vorschlag: Der BEE plädiert für die Einführung einer gesetzlichen Regelvermutung bezüglich § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Demnach sollen seismische Explorationen zur Aufsuchung von Erdwärme in der Regel nicht als erhebliche Störung im Sinne des genannten Paragrafen gelten. Die Regelung in § 14 BNatSchG, nach der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung nicht als Eingriff anzusehen sind, sollte ebenfalls um seismische Messungen auf solchen Flächen und entlang von öffentlichen, land- und forstwirtschaftlichen Wegen und Straßen erweitert werden.
Die aktuelle Genehmigungspraxis für Wasserkraftanlagen, insbesondere kleinere Anlagen, ist aufwendig und dauert häufig über zehn Jahre. Dies behindert das Repowering und die Nutzung vorhandener Potenziale erheblich. Dabei könnten durch technische Modernisierung und Digitalisierung Leistungssteigerungen von bis zu 200 % erreicht werden, ohne ökologische Maßnahmen wie Fischschutz und Fischdurchgängigkeit zu behindern.
BEE-Vorschlag: Ein wesentlicher Hebel zur Verbesserung ist die Übertragung des in § 2 EEG verankerten öffentlichen Interesses an Erneuerbaren Energien – insbesondere der flexibel einsetzbaren Wasserkraft – in das Wasserrecht. Dazu sollte ein entsprechender Passus in § 6 Abs. 1 WHG aufgenommen werden. Die Schutzgüterabwägung muss neben ökologischen Aspekten auch klima- und energiepolitische Belange angemessen berücksichtigen.
Zur Beschleunigung von Verfahren sind insbesondere die Anwendung von § 11a WHG, ein verbindlicher Unterlagenkatalog sowie eine Begrenzung von Nachforderungen erforderlich. Außerdem sollte eine Vollständigkeitsfiktion eingeführt werden: Wenn die Behörde nicht binnen vier Wochen reagiert, gelten die Unterlagen als vollständig (§ 11a WHG analog). Dies schafft Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller.
Beim Repowering mit bewährter Technik sollten nur zentrale Unterlagen, wie der technische Nachweis zu Fischschutzmaßnahmen, eine Stromertragsrechnung und die erwartete Leistungssteigerung, erforderlich sein. Weitere Fachgutachten sollten entfallen, sofern die Maßnahmen nach gültigen Standards umgesetzt werden.
Digitale Verfahren auf Basis signierter PDF-Dateien sowie frühzeitige Abstimmungen mit Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange können Verfahren zusätzlich straffen. Behörden sollten als koordinierende Partner agieren und Doppelprüfungen vermeiden.
Das öffentliche Interesse an Klimaschutz und Erneuerbaren Energien ist im Abwägungsprozess klar zu berücksichtigen. Dies erfordert eine Änderung der Vollzugspraxis, verbunden mit dem Signal an die Behörden, die Nutzung der Wasserkraft grundsätzlich zu ermöglichen und zu unterstützen.
Entscheidungsfristen kürzen
Die bisherige Regelung im WHG benachteiligt die Wärmeversorgung gegenüber der Stromerzeugung und steht im Widerspruch zum Ziel, den Anteil der Erneuerbarer Energien im Wärmesektor zu steigern. Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, dass für Anlagen, die hauptsächlich der Wärmeerzeugung dienen, bisher keine Entscheidungsfrist gilt, zumal sich die Genehmigungszeiträume in der Praxis nicht unterscheiden. Zudem sind die derzeit geltenden Fristen insgesamt zu lang. Die vorgeschlagene Fristenregelung orientiert sich an § 10 Abs. 6a BImSchG und zielt auf eine Beschleunigung und Vereinheitlichung der Fristenregelungen im Anlagenzulassungsrecht ab. Dadurch wird vermieden, dass Geothermieanlagen gegenüber fossilen Kraftwerken, für die die Fristen des BImSchG gelten, benachteiligt werden. Da wasserrechtliche Erlaubnisse für Geothermieanlagen in der Regel weniger komplex sind als Genehmigungen nach dem BImSchG, ist eine kürzere Frist sachgerecht.
BEE-Vorschlag: Im Rahmen des § 14a WHG müssen die Entscheidungsfristen verkürzt werden. Über die Erteilung einer Erlaubnis oder Bewilligung sollte innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden werden. Zudem sollte die Regelung auf Anlagen zur Wärmebereitstellung mit einer Kapazität von weniger als 1.500 Kilowatt ausgeweitet werden. Eine einmalige dreimonatige Fristverlängerung sollte der zuständigen Behörde nur eingeräumt werden, wenn dies aufgrund der Schwierigkeit der Prüfung oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist. Diese muss dem antragstellenden Unternehmen begründet werden.
Regulatorische Hemmnisse bei Floating-PV abschaffen
Das Wasserhaushaltsgesetz begrenzt die Installation von Floating-PV-Anlagen durch unverhältnismäßige Flächen- und Abstandsbeschränkungen und verhindert so die Nutzung erheblicher Potenziale. So ist auf künstlichen oder erheblich veränderten Gewässern ein Uferabstand von mindestens 40 Metern einzuhalten, zudem dürfen Anlagen höchstens 15 % der Wasseroberfläche bedecken. Da viele potenzielle Gewässer, wie beispielsweise Kiesgruben, nur über begrenzte Flächen verfügen, lassen sich Floating-PV-Anlagen unter diesen Vorgaben kaum wirtschaftlich realisieren. Die zusätzliche Flächenbegrenzung reduziert die mögliche Anlagengröße weiter. Naturschutzfachliche Auswirkungen werden bereits im Genehmigungsverfahren durch die zuständige Behörde geprüft und bei Bedarf mit Auflagen berücksichtigt.
BEE-Vorschlag: Die unverhältnismäßigen Flächenbegrenzungen in § 36 Abs. 3 Nr. 2 WHG sollten gestrichen werden.
Der am 6. August 2025 vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf des Geothermiebeschleunigungsgesetzes (GeoGB) zielt darauf ab, den Ausbau dringend benötigter Infrastruktur für Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeicher spürbar zu beschleunigen. Die gesetzliche Festschreibung dieser Infrastruktur als Vorhaben von überragendem öffentlichem Interesse findet große Zustimmung und schließt eine bislang bestehende rechtliche Lücke.
Aus Sicht des BEE sollte der Gesetzentwurf allerdings so überarbeitet werden, dass er alle technischen Varianten der Quellenerschließung für Wärmepumpen umfasst. In der aktuellen Fassung des GeoBGs, insbesondere in den §§ 1 bis 3, sowie in der vorgesehenen Änderung von § 3 Nr. 1 WHG sind die Begriffe zu eng gefasst. Der gesetzgeberische Anspruch, Verfahren für (Groß-)Wärmepumpen unabhängig von ihrer technischen Ausgestaltung zu entbürokratisieren, wird dadurch nicht vollständig erfüllt. Insbesondere die Formulierung in § 2 GeoBG, die sich auf Nebenanlagen und Bohrungen bezieht, greift zu kurz und erfasst nicht alle relevanten Quellenanlagen.
Darüber hinaus sollte das Gesetz auch den gesamten Prozess der Erdwärmegewinnung berücksichtigen. Die im GeoBG geplanten Erleichterungen sollten deshalb nicht nur für die Nutzung der Erdwärme selbst gelten, sondern auch für alle dazugehörigen Schritte wie Explorations- und Aufsuchungsmaßnahmen sowie für technische Anlagen zur Nutzbarmachung der gewonnenen Wärme. Dazu zählen insbesondere Wärmetauscher, Vorrichtungen zur Einspeisung in Wärmenetze und ORC-Anlagen zur Umwandlung der Wärme in elektrische Energie.
Zudem spricht sich der BEE dafür aus, den Gesetzentwurf um weitere zentrale Technologien der Wärmewende zu ergänzen, wie etwa die Nutzung von Flusswärme (Aquathermie) und kalter Nahwärme. Insbesondere Flusswärme bietet ein hohes Potenzial, um die Wärmeversorgung in Deutschland zu defossilisieren. Diese Chance wird im aktuellen Entwurf jedoch noch nicht ausreichend berücksichtigt. Eine umfassende Einbindung dieser Technologien ist notwendig, um den Erfolg der Wärmewende langfristig zu sichern. Mehr Details zur Position des BEE finden Sie in der entsprechenden Stellungnahme aus dem Juli 2025.
Der zügige Ausbau der Strom- und Gasnetze ist eine Grundvoraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Doch genau hier verhindern komplexe Verfahren, lange Genehmigungsprozesse und unklare Zuständigkeiten eine schnellere Umsetzung. In seiner Stellungnahme zur EnWG-Novelle aus dem Juli 2025 macht der BEE deutlich, dass der Netzausbau nur dann beschleunigt werden kann, wenn das Gesetz konsequent auf Bürokratieabbau und Standardisierung ausgerichtet wird.
BEE-Vorschlag:
» Der BEE fordert für Netzanschlussverfahren verbindliche Fristen, klar definierte Bearbeitungsstandards sowie eine digitale Antragstellung. Netzbetreiber sollen verpflichtet werden, aktuelle und transparente Informationen zu Netzkapazitäten und Anschlusspunkten bereitzustellen.
» § 42c EnWG zur Einführung von Energy Sharing ist aus Sicht des BEE grundsätzlich positiv zu bewerten. Es darf jedoch nicht durch eine zu theoretisch konzipierte Raumaufteilung, technische Ausschlüsse oder komplexe Abrechnungsmodelle entwertet werden. Die Umsetzung muss praktikabel, alltagsnah und technologieoffen erfolgen, damit die mögliche oder unmögliche Teilnahme am Energy Sharing für alle Endverbraucher und Endverbraucherinnen nachvollziehbar bleibt.
» Energiespeicher müssen im EnWG eindeutig als im öffentlichen Interesse verankert werden. Unklare Definitionen, unkonkrete Fristsetzung und uneinheitliche Genehmigungspraxen führen aktuell zu Verzögerungen. Der BEE fordert daher eine vereinfachte und rechtssichere Einbindung von Stromspeichern in Planungs- und Zulassungsverfahren.
» Die auslaufende Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) muss durch eine unbürokratische Nachfolgeregelung ersetzt werden, die Biogas- und Biomethanprojekte nicht durch zusätzliche Hürden behindert.
Für den Netzanschluss neuer Anlagen müssen Stromkabel von der Anlage bis zum zugewiesenen Netzanschlusspunkt gelegt werden. Die Verlegung des Stromkabels liegt in der Verantwortung des Projektierers. Dabei ist in der Regel eine Trassenlänge von mehreren Hundert Metern bis zu einigen Kilometern notwendig, die über eine Vielzahl verschiedener Eigentümerflächen führt. Projektierer haben jedoch nicht die gleichen Rechte zur Nutzung von Flächen zur Stromkabelverlegung wie Netzbetreiber, wodurch es hier häufig zu langwierigen Verzögerungen, überhöhten Nutzungsgebühren der Flächeneigentümer*innen kommt, was wiederum kostenintensive Umwege nach sich zieht.
Ein vergleichbares Problem besteht bei der Biomethanerzeugung. Ein großes Potenzial für die Erzeugung von Biomethan liegt in der Umrüstung bisheriger EEG-gestützter Biogasanlagen auf die Biomethaneinspeisung. Da viele EEG-gestützte Biogasanlagen selbst zu klein für eine wirtschaftliche Umrüstung sind, müssen sie zuvor mittels sogenannter “Rohbiogasleitungen” zu „Biogas-Clustern” zusammengeschlossen werden. Das jeweils erzeugte Biogas wird dabei unaufbereitet zu einer gemeinsamen Aufbereitungsanlage geleitet. Die Trassenlänge solcher Cluster liegt normalerweise im zweistelligen Kilometerbereich und muss über mehrere Grundstücke verlegt werden.
BEE-Vorschlag: Projektierer von EE-Anlagen sollten eine Duldungspflicht erhalten, um Stromkabel auf dem direktesten Weg zwischen der EE-Anlage und dem vom Netzbetreibenden zugewiesenen Netzanschlusspunkt zu verlegen. Als Vorbild könnte hier fast unverändert eine ähnliche Duldungspflicht nach § 134 im Telekommunikationsgesetz zur Verlegung von Breitbandleitungen dienen. In Bezug auf Rohgasleitungen ist eine Duldungspflicht zumindest für öffentliche Grundstücke sinnvoll.
Die bestehende nationale Wasserstoffnetzregulierung, wie sie derzeit im EnWG vorgesehen ist, bleibt aus Sicht des BEE hinter den europäischen Prinzipien der Netzregulierung zurück. Diesen zufolge müssen der diskriminierungsfreie Zugang Dritter (Third Party Access) und eine Kostenregulierung mit fairen und transparenten Netzanschlusskosten und Netzentgelten ermöglicht werden. Mit einem nach § 28n Abs. 1 EnWG verhandelten Netzzugang mit anfänglich hohen Netzanschlusskosten wird kein Level-Playing-Field zwischen Einspeiser bzw. Abnehmer und Wasserstoff-Infrastrukturbetreiber geschaffen. In der Vergangenheit hat ein verhandelter Netzzugang bereits zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten zwischen Marktteilnehmern und Netzbetreibern geführt, anstatt zu schnellen und diskriminierungsfreien Marktentwicklungen. Insbesondere für kleinere Abnehmer von Wasserstoff, wie zum Beispiel Wohnquartiere mit Brennstoffzelle, stellt ein verhandelter Netzanschluss eine große Hürde dar und führt zu ungleichen Netzzugangsbedingungen.
Beim Ausbau der Wasserstoffnetzinfrastruktur sollte zudem darauf geachtet werden, dass keine einseitige Kostenumwälzung auf die Anschlussnehmenden erfolgt. Dies würde dazu führen, dass seltener ein Netzanschluss bzw. die Umwidmung von Gas- auf Wasserstoffein- oder Ausspeisung gewählt wird. Damit würden der Infrastrukturaufbau und der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft verteuert und signifikant gebremst. Dies ist in hohem Maße kontraproduktiv, ineffizient und steht den Zielen der Energiewende insgesamt entgegen.
BEE-Vorschlag: Sinnvoll ist aus Sicht des BEE eine zeitliche Befristung des verhandelten Netzzuganges, der automatisch durch einen regulierten Netzzugang zu ersetzen wäre. Für den schnellen Markthochlauf ist zudem die Verbindung von möglichst vielen Erzeugern, Transporteuren und Verbrauchern die wichtigste Determinante. Die Höhe potenzieller Netzkosten kann dabei am effizientesten durch die Verteilung auf eine große Anzahl von Marktakteuren gesenkt werden.
Die Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) und mit ihr die besondere Regulierung der Netzeinspeisung von „Biogas“ treten zum 31. Dezember 2025 außer Kraft. Für die Gasnetzeinspeisung von Biomethan und anderen Gasen, die unter die Definition von „Biogas“ im EnWG fallen (Wasserstoff, synthetisch erzeugtes Methan etc. lt. § 3 Nr. 10g EnWG), gelten dann folglich nur noch die allgemeinen Regeln des EnWG, speziell § 17 Abs. 1 für den Gasnetzanschluss und § 20 Abs. 1 und Abs. 1b EnWG für den Gasnetzzugang. Dies stellt einen gravierenden Einschnitt in die Entwicklung der Biogas- und Biomethanerzeugung in Deutschland dar. Die spezielle Gasnetzregulierung für Biomethan in §§ 31–36 GasNZV war ein zentraler Treiber für den bisherigen Ausbau der Biomethaneinspeisung in Deutschland und Voraussetzung für zahlreiche Biomethanprojekte, die sich noch in Planung und Umsetzung befinden. Eine ersatzlose Streichung würde damit zahlreichen politischen Vorgaben widersprechen, insbesondere den Biomethan-Ausbauzielen im RePowerEU-Paket und der „Roadmap towards ending Russian energy imports” der EU-Kommission, der novellierten EU-Gasbinnenmarktrichtlinie (RL EU 2024/1789), der novellieren EU-Gasbinnenmarktverordnung (VO EU 2024/1789) sowie dem Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung. Mehr Informationen finden Sie in der BEE-Stellungnahme zur Netzregulierung und zum -zugang aus September 2021.
BEE-Vorschlag: Die speziellen Regelungen zum Gasnetzzugang und Gasnetzanschluss, die sich aktuell in der GasNZV finden, sollten nicht ersatzlos entfallen, sondern zeitnah durch Nachfolgeregeln ersetzt werden. Dies bedeutet insbesondere:
» Biogasanlagen im Sinne des EnWG müssen einen vorrangigen Anspruch auf die technische und wirtschaftliche Nutzung der Transport- und Verteilnetze einschließlich Untergrundspeicher haben. Außerdem müssen Netzbetreiber verpflichtet werden, die Transport- und Verteilnetze inkl. Untergrundspeicher ggf. entsprechend anzupassen.
» Der überwiegende Teil der Netzanschlusskosten muss vom Netzbetreiber getragen werden.
» Der Spielraum von Anlagen- und Netzbetreibern, auf individueller vertraglicher Basis von den gesetzlichen Vorgaben abzuweichen, sollte erweitert werden, z. B. bei der Mindestverfügbarkeit des Netzanschlusses (96-Prozent-Kriterium) oder dem Betrieb des Netzanschlusses durch den Anlagenbetreiber. Eine größere Flexibilität bei der Vertragsgestaltung kann spezifischen Netzkonditionen vor Ort besser Rechnung tragen sowie betriebs- und volkswirtschaftliche Kosten einsparen.
Biogas: Handhabbarkeit von Gärprodukten in der Landwirtschaft gewährleisten
Aktuell gelten in der Verordnung für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) für Behälter zur Lagerung von Gärprodukten deutlich schärfere Anforderungen als für Behälter zur Lagerung von (unvergorener) Gülle. Dies macht es unattraktiver, Gülle zu vergären. Da Gärprodukte und Gülle bei wesentlichen Umweltaspekten die gleichen Eigenschaften aufweisen, ist eine Ungleichbehandlung sachlich nicht gerechtfertigt.
BEE-Vorschlag: Die Anforderungen an Behälter zur Lagerung von Gärprodukten bzw. an Behälter zur Lagerung von Gülle sollten im Rahmen einer praxisgerechten Ausgestaltung aneinander angeglichen werden. Dabei ist stets das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Anforderungen zu überprüfen.
Biogas: Erhöhung der Schwellenwerte bei Biogasanlagen
Immer mehr Biogasanlagen fallen in den Anwendungsbereich der Störfallverordnung (StörfallV). In Verbindung mit erhöhten düngerechtlichen Anforderungen an die vorzuhaltende Lagerkapazität betrifft dies insbesondere güllevergärende Biogasanlagen – selbst solche im kleinsten Leistungssegment bis 100 kW. Die Anforderungen der StörfallV führen zu umfangreichen administrativen und finanziellen Aufwendungen und stellen damit ein erhebliches Hemmnis für den Ausbau der Güllevergärung dar. Zudem bindet eine zunehmende Anzahl an Biogasanlagen im Anwendungsbereich der StörfallV das bereits knappe Personal und verhindert eine angemessene Betreuung und Überwachung von klassischen Anlagentypen im Sinne der StörfallV wie Chemieanlagen.
BEE-Vorschlag: Um das Hemmnis zu beseitigen, könnte die Mengenschwelle zur Ermittlung von Betriebsbereichen an den deutlich höheren Schwellenwert für Erdgas und Biomethan angeglichen werden. Alternativ könnte auf den Schwellenwert nicht das Biogas, sondern – analog zum Erdgas – nur der Methananteil im Biogas angerechnet werden.
Die im Papier dargestellten Maßnahmen verdeutlichen, wie durch gezielte gesetzliche Anpassungen und eine praxisorientierte Auslegung bestehender Regelwerke spürbare Entlastungen erreicht werden können. Ein konsequenter Bürokratieabbau stärkt die Handlungsfähigkeit der Verwaltung, beschleunigt Investitionen und schafft Planungs- und Investitionssicherheit in allen Bereichen der Erneuerbaren Energien.
Damit diese Wirkung erzielt werden kann, müssen die rechtlichen Grundlagen konsequent weiterentwickelt und vereinheitlicht werden. Der Gesetzgeber ist gefordert, Unklarheiten und Widersprüche in den Gesetzestexten zu beseitigen, Zuständigkeiten klar zu ordnen und Verfahrensvorgaben zu harmonisieren. Nur durch eine kohärente Gesetzgebung, die die Ziele des Ausbaus der Erneuerbaren Energien in allen relevanten Rechtsbereichen verankert, kann der Anspruch der Modernisierungsagenda eingelöst werden.
Der BEE wird diesen Prozess weiterhin konstruktiv begleiten und seine Expertise aus der Praxis einbringen. Die beschleunigte Energiewende gelingt, wenn politische Zielsetzungen, rechtliche Rahmenbedingungen und behördliches Handeln ineinandergreifen. Ein moderner Staat, der Verfahren vereinfacht und Vertrauen in seine Abläufe schafft, bildet die beste Grundlage für ein wettbewerbsfähiges, resilientes und zukunftsfähiges Energiesystem.